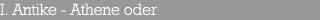II. Neuzeit
Wenn im Zuge der nachimperialen Entwicklung erneut eine sich von der Religion emanzipierende Ästhetik in Erscheinung tritt, dann unter gänzlich anderen gesellschaftlichen Bedingungen. Anders als in der antiken Handelsstadt spielt bei den in die feudalen Territorien der nachimperialen Zeit eingebetteten und eine relative Autonomie genießenden Städten ein territorialer Reichtum, der die kommerzielle Sphäre bedrohen könnte, keine Rolle. Deshalb entfallen hier auch den antiken Vorbildern vergleichbare kunstreligiöse Veranstaltungen und politisch-kultische Einrichtungen.
Indem im römischen Kaiserreich die allen religiösen Wurzeln und kultischen Bindungen entrissene Ästhetik ihre modellbildend-repräsentative Orientierungsfunktion für die Wahrnehmung und mustergültig-demon- strative Vorbildlichkeit fürs Verhalten einbüßt und sich auf eine bloße ornamentale Reproduktion der konsumtiven Wirklichkeit beziehungsweise klischeehafte Mimikry an sie reduziert, ist ihre antike Karriere beendet. Außerstande, den überbordenden exotischen Sinnesreizen und exzessiven synkretistischen Triebbefriedigungen, die aller regulativen Allgemeingültigkeit der Wahrnehmung und normativen Verbindlichkeit des Verhaltens ins Gesicht schlagen, zu trotzen, geschweige denn zu wehren, geht sie zusammen mit der im Sumpf ihres chaotischen Wohllebens und ihrer idiosynkratischen Gelüste versinkenden römischen Gesellschaft zugrunde.
Als auf den Trümmern der durch ihre Verwandlung in einen kolonialistischen Ausbeutungsapparat ebenso sehr imperial hypertrophierten wie final überforderten Handelsstadt, auf den Trümmern mit anderen Worten des untergegangenen römischen Imperiums, territorialherrschaftliche Gesellschaften alten Musters wiedererstehen, zeigt sich die Ästhetik als eigenständige Erscheinung verschwunden und findet sich, wie schon in den antiken Territorialherrschaften, zurückgenommen ins Glied kultischer Religiosität, stellt wieder nichts weiter mehr dar als einen integrierenden Bestandteil, ein phänomenales Element der ad majorem gloriam dei, Gott zum Gedächtnis und zum Lobpreis, geschaffenen und gepflegten Kultstätten, Kultgegenstände und Kultübungen.
Wenn mit anderen Worten in diesen auf den Trümmern des Römischen Reiches entstandenen Gesellschaften Elemente vorkommen und eine Rolle spielen, die aus heutiger Sicht ästhetischen Charakter aufweisen, dann nicht mehr, wie in der handelsstädtischen Antike der Fall, als Resultat eines im Rahmen der Identität der menschlichen Gattung sich haltenden bloßen Perspektivenwechsels, nicht mehr als Momente einer jenseits des menschlichen Alltags und praktischen Gebrauchs beziehungsweise darüber angesiedelten, aber deshalb doch nicht weniger menschlichen Sphäre eines kontemplativen Verhältnisses zur Welt und quasitheoretischen Umgangs mit ihr, sondern erneut als Ergebnis eines regelrechten Subjektwechsels und als Bestandteile einer Wesentlichkeit, die das menschlich-alltägliche Dasein, die Wirklichkeit der Welt ebenso sehr chronologisch außer Kraft setzt wie ontologisch aussticht, ebenso ewig antizipiert wie unendlich transzendiert.
Dennoch zeigt sich das ästhetische Moment nicht ein für alle Mal in der religiösen Sphäre aufgehoben, der gattungseigene Perspektivenwechsel nicht unwiderruflich im gottesgläubigen Subjektwechsel untergegangen. Nach Jahrhunderten der vergleichsweise unangefochtenen Geltung der als christliches Glaubenssystem etablierten Religion regt sich im Ausgang der Ära des so genannten Mittelalters und zu Beginn unseres als Neuzeit firmierenden Zeitalters erneut das Bedürfnis, das ästhetische Element aus seiner religiösen Einbindung und Umklammerung herauszulösen und als eine gesellschaftliche Erscheinung beziehungsweise eine funktionelle Sphäre sui generis in Szene zu setzen. Freilich handelt es sich dabei keineswegs um eine einfache Neuauflage oder Wiederholung der in der griechischen Polis als relativ selbständige Erscheinung ausgebildeten und dann vom Römischen Reich übernommenen und zugrunde gerichteten Ästhetik. Dazu sind die kultisch-theologischen Voraussetzungen und die politisch-ökonomischen Bedingungen, unter denen diese Auslösung des Ästhetischen aus dem religiösen Kontext und seine Erhebung aus der Rolle einer Dienstmagd der Gottheit zur Stellung einer eigenen quasigöttlichen Macht sich vollzieht, bei weitem zu verschieden.
Und tatsächlich sind diese Voraussetzungen und Bedingungen derart verschieden, dass bei genauerem Hinsehen die beiden Ästhetiken, die der von der griechischen Handelsstadt kreierten klassischen Antike und die der mit dem kommerziellen Aufschwung der Renaissance beginnenden Neuzeit, sich als nicht nur nach ihrer Struktur und Beschaffenheit, sondern auch und mehr noch nach ihrer Funktion und Bestimmung aparte und eigenständige Schöpfungen erweisen und dass letztlich ihre Gemeinsamkeit sich auf ihre effektive Emanzipation von und relative Distanz zu der sie von Haus aus ebenso sehr verbergenden wie beinhaltenden Sphäre theokratisch-kultischer Religiosität, sprich, darauf beschränkt, dass sie beide den von der Religion vollzogenen und die menschliche Gattung pro domo einer toto coelo anderen, heroisch-göttlichen Genese sprengenden Subjektwechsel auf einen durchaus im Rahmen der menschlichen Gattung sich haltenden und die ontologisch-generische Differenz in nichts weiter als eine empiriologisch-spezifische Distinktion überführenden Perspektivenwechsel reduzieren.
Was die antike und die neuzeitliche Ästhetik zuerst und vor allem voneinander trennt, sind die völlig verschieden gearteten politisch-ökonomi- schen Bedingungen der Gesellschaften, in denen sie jeweils entstehen und in Erscheinung treten. Wie gezeigt, ist in der Antike Ausgangslage der historischen Entwicklung der geographisch, ethnisch, politisch und ökonomisch fundierte Gegensatz zwischen den im östlichen Mittelmeerraum vorherrschenden theokratisch-territorialherrschaftlichen Staatswesen und den an ihrer Peripherie Platz greifenden und sich erfolgreich behauptenden republikanisch-handelsstädtischen Gemeinwesen mit ihren unterschiedlichen Formen einerseits eines fronwirtschaftlich produzierten, religionsstiftend-territorialen und andererseits eines per Austausch akkumulierten, weltbezogen-kommerziellen Reichtums. Und wie des Weiteren gezeigt, resultieren die Probleme, die dieser Gegensatz für die Handelsstadt mit sich bringt, nicht unmittelbar aus ihm als solchem, sondern aus der Präsenz beider Reichtumsformen innerhalb der Handelsstadt selbst, die wiederum Konsequenz der amphibolischen Natur der antiken Handelsstadt ist, Konsequenz mit anderen Worten der Tatsache, dass letztere sich an der Peripherie der traditionellen Territorialherrschaften und im Gegensatz zu ihnen nur etablieren und behaupten kann, weil sie über ein territorialherrschaftliches Element, eine sich durch Bodenständigkeit und Wehrkraft auszeichnende landbesitzende Aristokratie verfügt, die aus ihrem territorialherrschaftlich-fronwirtschaftlich bestellten Landbesitz, ihrem despotisch bewirtschafteten Oikos, territorialen Reichtum zieht und diesen als Grundlage ihrer innerstädtisch-aristokratischen Existenz in die Handelsstadt mitbringt.
Wie dieser Reichtum einerseits notwendige Folge der aparten territorialen Verankerung ist, so schafft er andererseits aber auch die oben geschilderten Probleme, insofern er einen nicht kommerziell vermittelten Machtfaktor in der Handelsstadt darstellt, der, wenn er von seinen aristokratischen Eigentümern zum Zwecke ihres persönlichen Machstrebens und privaten Geltungsbedürfnisses eingesetzt wird, die Eintracht des Gemeinwesens zerstört und zur Fraktionierung und Klientelbildung führt.
Dieser durch den nichtkommerziell-territorialen Reichtum in der Stadt heraufbeschworenen Gefahr innerstädtischen Zerwürfnisses und Zerfalls zu wehren, ist Aufgabe der beschriebenen poliseigenen Fortsetzung und Revision der traditionellen Religion, der Umfunktionierung der territorialherrschaftlichen Götter und Umrüstung ihrer Kulte, die dafür sorgt, dass der territoriale Reichtum qua Liturgie der Polis zugewendet, sprich, gemeinwohldienlich verwendet beziehungsweise gemeinsinnig verschwendet wird. Dabei deutet schon das Attribut ,,gemeinsinnig" darauf hin, dass es sich bei jener Umrüstung der alten Götterkulte um alles andere als um eine reine Verschwendung handelt und dass die letzteren in ihrer transformierten Gestalt durchaus einen nützlichen Zweck erfüllen und nämlich den Zusammenhalt des politischen Gemeinwesens fördern, indem sie letzterem den Spiegel vorhalten und einen Begriff von seinen auszeichnenden Errungenschaften und seiner erhaltenswerten Eigenart vermitteln.
Darüber hinaus dienen sie aber auch noch, wie erinnerlich, zur Bewältigung eines weiteren gravierenden Problems, das sich daraus ergibt, dass die im Marktsystem implizierte Entkräftung der im territorialen Reichtum gründenden traditionellen Religion zugleich die Abdankung der von dieser kultisch beschworenen und rituell sanktionierten und für die Weltwahrnehmung und das Sozialverhalten maßgebenden archetypischen Objekte und paradigmatischen Verhaltensweisen bedeutet und dass das Marktsystem selbst keinen auf vergleichbare Allgemeingültigkeit und Verbindlichkeit Anspruch erhebenden Ersatz für das Verlorene bietet, dass deshalb auch die Wahrnehmung und das Verhalten in der Handelsstadt unter der Drohung einer allen sozialen Konsens zerstörenden privativen Partikularisierung steht und einer alle kulturelle Homogenität untergrabenden Tendenz zur idiosynkratischen Auflösung ausgesetzt ist. Hier erfüllen nun die poliskonform umgerüsteten Götterkulte die zusätzliche Aufgabe, den fehlenden Ersatz zu schaffen, indem sie das, was als heroische Archetypen und göttliche Paradigmata mitsamt der traditionellen territorialen Religion verloren gegangen ist, als kultisch sanktionierte Objektmodelle und rituell reaffirmierte Verhaltensmuster wiederaufzunehmen und zur Geltung zu bringen erlauben.
Nicht mehr als ontologisch-theologische, die Wirklichkeit der Welt beschwörende und den Bestand des Daseins garantierende Originale und Vorbilder, wohl aber als phänomenologisch-ästhetische, die Allgemeingültigkeit der Erfahrung sicherstellende und für die Verbindlichkeit des Verhaltens sorgende Modelle und Muster werden die im Rahmen der Kultveranstaltungen der Polis formell oder ihrer theoretischen Stellung nach immer noch als religiöse Topoi behandelten, tatsächlich aber oder ihrer praktischen Funktion nach zu sozialen Figuren säkularisierten heroischen Archetypen und göttlichen Paradigmata in Anspruch genommen, um der durch den Markt den Beschränkungen und Fixierungen des territorialherrschaftlich-traditionellen, ebenso kultisch-repetitiven wie agrarisch-zyklischen Lebens entrissenen Bürgerschaft ein Mindestmaß an weltbezüglich-objektivem Konsens und an verhaltensspezifisch-kommunaler Uniformität beizubiegen.
Schauen wir uns vor diesem Hintergrund der kurz zusammengefassten antiken Situation die Verhältnisse an, die sich nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches in Europa herausbilden, so stechen die Unterschiede ins Auge. Der augenscheinlichste und vielleicht entscheidende Unterschied ist, dass Handelsstadt und Territorialherrschaft, die beiden maßgebenden Gesellschaftsformationen, nicht wie in der Antike geographisch und politisch getrennt, keine räumlich und staatlich eigenständigen und sich als mehr oder minder voneinander unabhängig behauptenden Gemeinwesen sind, sondern dass beide jetzt einen zusammenhängenden Komplex bilden, die Handelsstädte sich in den territorialherrschaftlich-fronwirtschaftlichen Kontext eingebettet und, wenngleich de jure der Territorialherrschaft untertan und zinspflichtig, politisch, ökonomisch, fiskalisch und juridisch unter ihre Kuratel gestellt, doch aber de facto in all jenen Hinsichten und auf vielerlei Weise von der Territorialherrschaft mit Freiheiten und Privilegien ausgestattet und deshalb in ihren ökonomischen Strukturen und in ihrer politischen Ordnung relativ apart und weitgehend autonom zeigen.
Bedingung der Möglichkeit dieser Apartheit und Autonomie ist, wie an anderer Stelle 6 genauer ausgeführt, die christliche Religion und heilsgeschichtliche Orientierung der nachimperialen Gesellschaft beziehungsweise sind die durch jene heilsgeschichtliche Orientierung ins Leben gerufenen mönchisch-klösterlichen Freiräume, in deren Schutz und unter deren Schirm die wieder aufkommenden Handwerke und die im Zusammenhang mit ihnen neu erstehende kommerzielle Funktion, unbeschränkt und unbelastet durch herrschaftliche Bevormundung und fronwirtschaftliche Ansprüche, gedeihen und sich entfalten können.
Und Bedingung der Wirklichkeit dieser Autonomie und Apartheit ist das Interesse, das die feudale Herrschaft an den kommerziell ebenso sehr miteinander kommunizierenden wie mit der Herrschaft kontrahierenden handwerklichen Produktionsgemeinschaften nimmt, und der Vorteil, den sie daraus zieht – ein Interesse und Vorteil, die so groß sind, dass die verschiedenen feudalen Herrschaften sich nach Kräften bemühen, auf ihren eigenen Territorien den Zentren solchen von fronwirtschaftlicher Untertänigkeit vergleichsweise freien Wirtschaftens Raum und Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten, und dass sie damit der Entstehung einer Vielzahl von relativ freien und selbstverwalteten Handelsstädten Vorschub leisten, die die aus ihnen erwachsende kommerzielle Funktion zu einem territoriumübergreifenden und dem territorialherrschaftlichen Zusammenhang quasi komplementären Marktsystem verbindet und organisiert.
In der räumlichen Verschränkung und der bei aller gesellschaftlich-konstitutionellen Verschiedenheit staatlich-institutionellen Verbundenheit der marktwirtschaftlichen Stadtgemeinschaften und der fronwirtschaftlichen Territorialgesellschaften fungieren die Territorialherren gleichermaßen als Interessen- und Handelspartner und als Schutzpatrone und Förderer des von der kommerziellen Funktion aus den Stadtgemeinschaften gebildeten Handelssystems. So gewiss die Territorialherren wegen der mannigfachen konsumpraktischen, strategischen und fiskalischen Vorteile, die sie aus dem Marktsystem ziehen, die Ansiedlung der als tragende Elemente des Systems firmierenden städtischen Produktionsgemeinschaften auf ihrem Territorium betreiben und diesen den nötigen Freiraum bieten, so gewiss sorgen sie nun natürlich auch dafür, dass diese städtischen Produktionsgemeinschaften mitsamt der sie zum Marktsystem verbindenden kommerziellen Funktion Schutz und Sicherheit genießen und ungestört ihren auch und nicht zuletzt den Territorialherren nützlichen Aktivitäten obliegen können.
Und das wiederum bedeutet, dass eine landbesitzende Aristokratie, wie sie in der Antike zur Handelsstadt unabdingbar dazu gehört und dieser ihren spezifischen amphibolischen Charakter verleiht, sich in den nachantiken Territorialgesellschaften erübrigt und dort in der Tat gar keinen Platz hätte beziehungsweise den dort als politische Einheit realisierten und in der Personalunion des Territorialherren Gestalt gewordenen Verbund aus fronwirtschaftlicher Territorialgesellschaft und marktwirtschaftlicher Stadtgemeinschaft nur stören oder sprengen könnte. Weil die Handelsstädte des nachantiken Mittelalters mit den Territorialherren nicht nur, wie sie das in der Antike tun, kommerzielle Austauschbeziehungen pflegen, sprich, ökonomisch kontrahieren, sondern auch mit ihnen ein soziales Gemeinwesen bilden, sprich, politisch und militärisch im Einvernehmen sind, entfällt für sie gleichermaßen die Notwendigkeit und die Opportunität, sich ein eigenes territoriales Standbein zuzulegen, sprich, sich mit einer von den Territorialherren unterschiedenen und ihnen gegebenenfalls Paroli bietenden, ebenso stadtspezifischen wie landbesitzenden Aristokratie zu verbünden.
Zwar bilden auch die solchermaßen in die Territorialherrschaft eingebetteten und mit ihr kohabitierenden Handelsstädte im Laufe ihre Entwicklung quasiaristokratische Gruppen aus, aber bei diesen als Patrizier beziehungsweise Gentry in die Geschichte eingegangenen Gruppen handelt es sich um Geschöpfe der kommerziellen Funktion selbst, die ihren auf dem Markt erworbenen Reichtum durch den Kauf von Grundbesitz oder Landgütern zum Teil oder zur Gänze in territorialen Reichtum überführen, der indes ebenso wenig wie der originär territorialherrschaftlich fundierte Reichtum in einem Gegensatz zum kommerziellen steht, sondern sich vielmehr sogleich in einer ihrerseits kommerziell bestimmten Symbiose, einem marktsystematisch vermittelten Austauschverhältnis aufgehoben findet.
In der Tat ist dies der aus der zugleich politisch-konstitutionellen Kontinuität und ökonomisch-institutionellen Diskretheit, der zugleich staatlichen Einheit und gesellschaftlichen Getrenntheit von marktwirtschaftlich-handelsstädtischer Gemeinschaft und fronwirtschaftlich-territorialherr- schaftlicher Gesellschaft resultierende wesentliche Unterschied zur antiken Situation, dass der territoriale Reichtum von vornherein und, was sein Erscheinen im kommerziellen Zusammenhang betrifft, in toto ins Marktsystem integriert ist und dass der kommerzielle Kontext den territorialen Reichtum ebenso wenig als nichtkommerziellen Fremdkörper erfährt, ihn ebenso gewiss auf einen rein kommerziellen Faktor, auf das als allgemeines Äquivalent in den Austauschzusammenhang eingespeiste herrschaftliche Edelmetall beschränkt findet, wie er die Territorialherrschaft selbst auf die Rolle einer am Markt einzig und allein als Konsument beteiligten Partei vereidigt, ihren Beitrag zum Marktsystem strikt darauf reduziert, dass sie mittels ihres territorialen Reichtums oder vielmehr bloß ihres den territorialen Reichtum als Herrengut par excellence symbolisierenden oder repräsentierenden Vorrats an Edelmetall das kraft Marktmechanismus vom Markt erwirtschaftete Mehrprodukt in seinem Wert zu realisieren, sprich, in die Form des Mehrwerts, des für weitere akkumulative Prozesse tauglichen kumulierten allgemeinen Äquivalents oder Geldes zu überführen und umzumünzen hilft.
In diesem zugleich als staatlich-politisches Universum, als topische Einheit konstituierten und als gesellschaftlich-ökonomische Parallelwelten, als dynamische Dualität institutionalisierten Verbund aus agrarischer Territorialherrschaft und städtischem Marktsystem, in dem die ihre politische Macht über das Marktsystem im Idealfall einzig und allein als Schutzpatronin übende Territorialherrschaft ökonomische Relevanz für das Marktsystem nur als Konsumentin gewinnt und in das deshalb auch ihr territorialer Reichtum bloß auf kommerziellem Weg, als im Austausch gegen besondere Güter des Marktes geliefertes allgemeines Äquivalent Eingang findet – in einem solchen Verbund ist kein Raum für jenes ebenso störungsanfällige wie konkurrenzträchtige Nebeneinander von kommerziellem und territorialem Reichtum, wie es die zwieschlächtige Konstitution der antiken Handelsstadt, ihre wesentliche Zusammensetzung aus marktwirtschaftlich organisierter Unterschicht und fronwirtschaftlich fundierter Oberschicht, aus handarbeitenden Banausen und grundbesitzenden Aristokraten mit sich bringt.
Es ist mit anderen Worten kein Raum für jene Bedrohung der als kommerzieller Betrieb funktionierenden handelsstädtischen Ordnung, die der von der Aristokratie aus ihren Landgütern fronwirtschaftlich gezogene und in die Handelsstadt überführte territoriale Reichtum insofern bedeutet, als er den Aristokraten erlaubt, sich am Markt vorbei oder unabhängig von ihm eine Machtstellung im Gemeinwesen zu verschaffen und zur Befriedigung persönlichen Ehrgeizes oder privativer Geltungssucht den gemeindlichen Zusammenhang sprengende soziale Klientelen und politische Fraktionen zu bilden.
Und weil mangels solchen ebenso kommerziell unvermittelten wie als politischer Machtfaktor ins Gewicht fallenden innerstädtisch-territorialen Reichtums diese Bedrohung der sozialen Eintracht und Gefährdung des politischen Friedens der dem territorialherrschaftlichen Kontext als ebenso konstitutiver Bestandteil wie eigenständige Einrichtung integrierten mittelalterlichen Handelsstadt erspart bleibt, kann die letztere nun aber auch getrost auf die geschilderten liturgischen Anstrengungen und kultischen Veranstaltungen verzichten, deren die antike Handelsstadt zur Aufrechterhaltung der ökonomischen Ordnung und des politischen Gleichgewichts bedarf. Weil es keinen territorialen Reichtum gibt, der sich als Sand im kommerziellen Getriebe unheilvoll zur Geltung bringen könnte, kann die mittelalterliche Handelsstadt auf jene Umfunktionierung der Religion und Umrüstung ihrer Rituale verzichten, mittels deren die antike Handelsstadt eine gemeinwohldienliche Verwendung beziehungsweise dem Gemeinsinn förderliche Verschwendung solchen ihr als potenzieller Konfliktstoff ins Haus stehenden territorialen Reichtums erzwingt. Gleichermaßen unterstützt und geschützt durch eine territoriale Herrschaft, die sie sich ebenso sehr kraft ihrer städtischen Freiheit und Selbstverwaltung politisch vom Leib zu halten vermag, wie dank der konsumpraktischen, strategischen und fiskalischen Vorteile, die sie ihr bietet, ökonomisch zu verbinden und zu verpflichten versteht, kann die mittelalterliche Handelsstadt ihr Marktsystem ebenso frei wie ungestört entfalten und braucht für diesen Entfaltungsprozess keinerlei religiöse Absicherung oder kultische Weihe.
Was aber ist mit der dritten liturgisch fundierten Leistung, die, wie gezeigt, die in der antiken Handelsstadt vollzogene Umfunktionierung der Götter und Umrüstung ihrer Kulte, sprich, die Revision und Fortsetzung der traditionellen Religion durch die Polis, erbringt? Schließlich dient ja in der antiken Handelsstadt die revidierte, in eine Einrichtung der Polis, ein Politikum, verwandelte Religion nicht nur dem doppelten Ziel, den in der Stadt präsenten nichtkommerziell-territorialen Reichtum dem Gemeinwohl zuzuführen beziehungsweise für den Gemeinsinn in die Pfanne zu hauen, sondern sie erfüllt darüber hinaus und quasi unter dem Deckmantel jener liturgischen Zielsetzung auch noch die als ästhetisch definierte Aufgabe, Ersatz für die durch den Markt und seinen Paradigmenwechsel vom sakralen Typus zum kommerziellen Wert oder vom göttlichen Paradigma zum sächlichen Pretium außer Kraft gesetzten archetypischen Objektvorstellungen und paradigmatischen Verhaltensweisen zu schaffen, die vor der durch den Markt gesetzten neuen Identität der Dinge und Verhältnisse das gesellschaftliche Leben bestimmt und reguliert haben.
Ein Ersatz für diese vom Markt verdrängten archaischen Sicht- und paradigmatischen Verhaltensweisen ist nötig, weil ja der Markt in seiner gesellschaftlichen Synthesisfunktion und Geltung beschränkt ist und die Dinge und Bewandtnisse außerhalb seiner, im nicht durch ihn organisierten konsumtiven Sozial- beziehungsweise kollektiven Privatleben, ihre als Wert oder Pretium ausgewiesene neue Identität verlieren, so dass die Wahrnehmung und das Verhalten eines haltgebend-regulativen Konsenses beziehungsweise einer richtungweisend-normativen Kommunalität bedürfen, sollen die Einzelnen nicht unter dem Eindruck der ihnen mittels Markt begegnenden Erfahrungsvielfalt und Reizüberflutung einer unaufhaltsamen Idiosynkratisierung und Partikularisierung ihres Vorstellens und Meinens beziehungsweise einer galoppierenden Zersplitterung und Auflösung ihres Vorhabens und Reagierens erliegen.
Hier nutzt nun das antike Gemeinwesen seine in erster Linie zur liturgischen Bewältigung des Störfaktors territorialer Reichtum in politische Instrumente und Funktionen der Polis umfunktionierten Götter und umgerüsteten Kulte in zweiter Linie dazu, die im Rahmen der traditionellen Religion von den Göttern sanktionierten und in ihren Kulten inszenierten objektstiftend archetypischen Bestimmungen und verhaltensdeterminierend paradigmatischen Haltungen erneut ins Spiel und als Ersatz für die vom Markt nicht zur Verfügung gestellten Regulative der Wahrnehmung und Normen des Verhaltens zur Geltung zu bringen.
Ihre Stoßrichtung und Bedeutung freilich haben die solchermaßen wiederaufgenommenen Archetypen und Paradigmata damit, wie oben erläutert, geändert. Sie erfüllen nicht mehr den Zweck, die alles in Frage stellende Negativität eines toto coelo anderen Subjekts zu bannen und letzteres als die im Gegenteil alles setzende und sanktionierende heroische Macht und göttliche Instanz zu erweisen, sondern dienen nurmehr dazu, die Objektivität und Intersubjektivität vor Partikularisierung und Auflösung zu bewahren, sprich, der Wahrnehmung des Einzelnen ihre nicht in Idiosynkrasie verschwindende Konsensfähigkeit und dem persönlichen Verhalten seine nicht der Privatisierung verfallende Kommunalität zu erhalten. Sie sind, um die obige Formulierung noch einmal aufzugreifen, nicht eigentlich mehr Archetypen, das Sein der irdischen Empirie stiftende beziehungsweise die Wirklichkeit des menschlichen Daseins garantierende Originale oder Ur-Sachen, sondern bloß noch Muster oder Vorbilder, Normen für das menschliche Dasein setzende Modelle beziehungsweise der Wahrnehmung und dem Verhalten Orientierung und Halt gewährende Prototypen.
Wenn aber in der mittelalterlichen Handelsstadt mangels konfliktträchtig territorialen Reichtums die zur Bewältigung solchen Störfaktors erforderlichen religiösen Einrichtungen und kultischen Veranstaltungen entfallen, wer oder was erfüllt dann hier jene in der antiken Handelsstadt von letzteren wahrgenommene Funktion einer die Objektwahrnehmung formierenden Modellbildung und das Sozialverhalten normierenden Vorbildlichkeit? Wer oder was sorgt in der mittelalterlichen Handelsstadt dafür, dass die von der kommerziellen Funktion als Wert oder Pretium eingeführte und aber auf das Marktsystem beschränkte neue Identität der Dinge und Verhaltensweisen nicht eben deshalb, weil sie auf das Marktsystem eingeschränkt ist und außerhalb seiner ihre Geltung verliert, negativ Raum lässt, wo nicht gar positiv den Grund legt für eine im nichtkommerziell konsumtiven Sozialleben oder kollektiven Privatleben grassierende und den Einklang beziehungsweise Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft in Frage stellende Partikularisierung der Wahrnehmung und Privatisierung des Verhaltens? Anders als die Archetypen und Paradigmata der antiken Religion entstammen die der christlichen Religion nicht einem territorialherrschaftlich-ursprungs- mythischen Zusammenhang, sondern sind dem Erdenleben des Heilands entnommene und gratia dei und unabhängig vom Gesellschaftstypus den Menschen als Überbrückungshilfe für die Zeit bis zur Erlösung gegebene Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen. Als Gottesgeschenk, das nur den transitorischen Aufenthalt auf Erden ermöglichen soll, sind die christlichen Archetypen und Paradigmata veränderlicher und empirisch anpassungsfähiger als die der antiken Religion, die einer zwanghaften Beschwörung der Substantialität der Welt und Positivität des Daseins entspringen. Eben weil sie nicht an einen bestimmten Daseins- und Vergesellschaftungsmodus gebunden sind, erübrigen sich im Falle ihrer Säkularisierung, sprich, Ästhetisierung jene Übersetzungs- und Transformationsleistungen, die die antike Handelsstadt erbringen muss.
Indes, die Frage geht von einer gänzlich falschen Voraussetzung aus, von der Prämisse nämlich, dass in der mittelalterlichen nicht anders als in der antiken Handelsstadt das Inkrafttreten der kommerziellen Funktion und ihres Marktsystems einen die Wahrnehmung der Dinge und das Verhalten in der Welt betreffenden veritablen Paradigmen- und Identitätswechsel impliziert, dass mit anderen Worten die per Marktsystem introduzierte und als Wert oder Pretium bestimmte neue Identität der Dinge und Verhältnisse einen radikalen Bruch mit den vom territorialherrschaftlichen Zusammenhang tradierten und als Typus oder Paradigma erscheinenden alten Anschauungs- und Handlungsformen bedeutet, dass die neue, marktvermittelte Identität der Dinge und Relativität des Verhaltens die der territorialen Gesellschaft entstammenden und zugehörigen sakralen Archetypen und göttlichen Paradigmata außer Kraft setzt und verdrängt und deshalb die von letzteren bis dahin wahrgenommenen objektspezifischen Bestimmungs- und verhaltensbezüglichen Orientierungsfunktionen zum dringenden Desiderat werden lässt.
Hier nämlich kommt der zweite wesentliche Unterschied zwischen der vorimperialen, antiken und der nachimperialen, mittelalterlichen Handelsstadt ins Spiel, dass die letztere nicht nur keinen als Konfliktpotenzial in Frage kommenden innerstädtischen territorialen Reichtum kennt, sondern dass sie auch in einem weit weniger gespannten oder zu Bruch und Verdrängung disponierenden Verhältnis zur umgebenden territorialherrschaftlichen Gesellschaft steht und weit entfernt davon ist, für die Einführung und Durchsetzung der marktvermittelten und als quantitative Wert- oder Äquivalenzbeziehung firmierenden neuen Identität der Dinge und Relativität des Verhaltens die Preisgabe einer von der Territorialgesellschaft gepflegten kultvermittelten und als qualitatives Wahrheits- oder Repräsentationsverhältnis figurierenden alten Identität der Archetypen und Relativität der Paradigmata in Kauf nehmen zu müssen.
Tatsächlich nämlich – und eben dies macht den ganzen Unterschied! – sind jene qualitativen, als Originale die Welt zur Kopie oder als Ur-Sachen die Wirklichkeit zum Exemplar erklärenden Archetypen und Paradigmata, die auch in den nachimperialen territorialen Gesellschaften anzutreffen sind und für deren konsensuelle Bestimmung und kommunale Orientierung eine ähnlich maßgebende Rolle spielen wie für die antiken Territorialgesellschaften, anders als in der Antike keine auf territorialgesellschaftlichem Boden gewachsenen beziehungsweise der territorialherrschaftlichen Ordnung entsprungenen. Die Objektivität stiftenden Archetypen und Verhalten determinierenden Paradigmata der postimperialen Zeit sind ebenso wenig Produkte der territorialen Gesellschaft und ihrer herrschaftlichen Ordnung, wie die diese Archetypen und Paradigmata dogmatisch zur Geltung und kultisch zum Tragen bringende Religion selbst Geschöpf des territorialherrschaftlichen Zusammenhangs ist.
Diese Religion, das Christentum, ist vielmehr Resultat des Konkurses und Zusammenbruchs, den die alten Territorialherrschaften in der Konsequenz der auf handelsstädtischer Grundlage sich vollziehenden imperialen Entwicklung erleiden. 7 Was bei jenem Konkurs zugrunde geht, ist das Grundprinzip der alten, territorialherrschaftlichen Religion – das Prinzip, dass die Götter und ihre Kulte dem Zweck dienen, ein ex improviso territorialen Reichtums auftauchendes und den irdischen Reichtum in specie ebenso wie das menschliche Dasein in genere mit Irrealisierung und Disqualifizierung bedrohendes ontologisch differentes und chronologisch diskretes Subjekt, negativ gefasst, zu bannen und zu verdrängen, positiv ausgedrückt, in eine das menschliche Dasein und seine irdische Welt vielmehr affirmierende und sanktionierende Macht zu überführen und umzufunktionieren. Beweis und Besiegelung dieser gelungenen Umfunktionierung ist die Übereignung des territorialen Reichtums an die Götter, die, indem sie ihn in persona der als ihre Stellvertreter auf Erden firmierenden Territorialherren annehmen und als solchen goutieren, ihre affirmative und von Verneinung und Verwerfung weit entfernte Haltung zur Welt und ihren Früchten kundtun.
Die imperiale Entwicklung aber treibt mit dem Kaiserkult, in dem sie kulminiert, die traditionellen territorialherrschaftlich-theokratischen Religionen in den Ruin und dekuvriert wie die Götter selbst als bloße Vorwände und Popanze der unter ihrer Camouflage den territorialen Reichtum okkupierenden und die mit ihm verknüpfte gesellschaftliche Macht usurpierenden Territorialherren, so ihre Kulte als im Grunde nur dieses asoziale Kalkül und diesen geheimen Zynismus gesellschaftlicher Herrschaft zu kaschieren und vom Bewusstsein fernzuhalten gedachte Veranstaltungen. Und gleichzeitig resultiert die imperiale Entwicklung, wie durch die letzten Jahrhunderte des Römischen Reiches bezeugt, in einem allgemeinen Hauen und Stechen, einem agonalen Kampf um die imperiale Beute, der die Provinzen des Reiches verwüstet, seine Populationen aufreibt und seine ökonomischen Grundlagen zerstört.
Angesichts dieses zugleich politisch-ökonomischen und dogmatisch-kultischen Zusammenbruchs der Weltordnung, dieser das Sozialleben nicht weniger als den Stoffwechsel mit der Natur aus den Angeln hebenden Vernichtungsorgie, die Hand in Hand geht mit einem Desillusionierungsprozess, der alle mit den traditionellen Götterkulten verknüpften Wertgewissheiten und Glaubensvorstellungen, Überzeugungen und Hoffnungen, die sich gegen das irdische Unglück und menschliche Elend etwa aufbieten ließen, Lügen gestraft und demontiert zeigt – angesichts dieses praktischen ebenso wie theoretischen, das Handeln ebenso wie das Denken heimsuchenden Konkurses verfallen die Menschen tiefer Resignation und Verzweiflung, verlieren ihr Interesse an der religiösen Affirmation der in Scherben fallenden Welt und der kultischen Sanktionierung des vor die Hunde gehenden menschlichen Daseins und stellen sich erstmals jenem von der Götterreligion verdrängten und umfunktionierten ontologisch anderen Sein und chronologisch verschiedenen Subjekt, das mit der unbedingten Indifferenz, mit der es den irdischen Dingen begegnet, und der absoluten Negativität, die es der menschlichen Sphäre beweist, exakt ihrer Perspektiv- und Trostlosigkeit, ihrem desolaten Lebensgefühl und ihrer Endzeitstimmung entspricht.
Freilich stellen und öffnen sie sich jener unbedingten Indifferenz und absoluten Negativität à fonds perdu der vom Kaiserkult in den Offenbarungseid getriebenen traditionellen Religionen nicht ohne eine doppelte Reservation, die sie vor der vollen Wucht und Vernichtungskraft jenes unendlich differenten Seins und absolut anderen Subjekts schützt und bewahrt. Einerseits nämlich lassen sie sich durch eine marginale Sekte, die jüdisch-messianische Religionsgemeinschaft, den Glauben an die Möglichkeit vermitteln, die an sich unüberbrückbare ontologische Kluft zwischen dem Sein des anderen Subjekts und dem eigenen Dasein, das Schein ist, dennoch zu überbrücken und aus dem unerträglichen Diesseits ins eigentlich unerreichbare Jenseits dennoch hinüberzugelangen. Und andererseits entnehmen sie einer zentralen Denkschule, der griechisch-platonischen Philosophie, die Botschaft, dass es sich bei dem ontologisch verschiedenen Sein des anderen Subjekts nicht um ein aus Sicht des irdischen Daseins schieres Nichts, ein in unendlicher Negativität sich erschöpfendes und jeder näheren Bestimmung, jeder positiven Qualität entzogenes, absolut abstraktes Anderssein handelt, sondern dass sich dieses Jenseits durchaus in einer Relation zum Diesseits wahrnehmen und nämlich als ein den Schein im Sein aufhebendes, das Nichts zur bestimmten Negation konkretisierendes Ideenreich erkennen lässt, das nach Maßgabe der Absicht, sich aus dem irdischen Verderben in es hinüberzuretten, Himmelreich ist.
Dies also, dass sich dank platonischem Messianismus das Sein des anderen Subjekts all der unendlichen Indifferenz und absoluten Negativität, mit der es der irdischen Welt begegnet und die es dem menschlichen Dasein beweist, zum Trotz als ein Zuflucht verheißendes Positivum, ein Himmelreich, herausstellt, ermöglicht es den an der imperialen Welt und ihrer Auflösung und Zerstörung Verzweifelnden, sich eben dem zuzuwenden, eben das als die wahre Wirklichkeit anzuerkennen, was ihnen bis dahin schrecklichstes Anathema oder vielmehr unvorstellbarstes Tabu war und was vom Bewusstsein fernzuhalten beziehungsweise für das Bewusstsein umzudeuten, oberstes Anliegen aller bisherigen Heroenkulte und theokratisch-opferkultlichen Religionen war. Als höchst annehmliche Perspektive und in der Tat äußerst erstrebenswertes Ziel lässt nun jenes zum Himmelreich entfaltete und aufgetane toto coelo andere Sein die Menschen in dem Maß, wie sie sich ihm zuwenden und ihr Sinnen und Trachten auf es richten, von der irdischen Welt und ihrem eigenen Dasein sich abwenden und das Interesse daran verlieren.
Beides, die irdische Welt und das eigene Dasein, werden für die vom himmlischen Sein Eingenommenen und Angezogenen zu einer Schein- und Schattensphäre, in die sie sich hineingeworfen finden, die sie bestenfalls mit Befremden und Gleichgültigkeit, schlimmstenfalls mit Ekel und Abscheu erfüllt, in der sie sich wie Vertriebene und Verbannte fühlen und aus der ins wahre Sein hinüberzugelangen, die hinter sich zu lassen und zu vergessen, ihr innigster Wunsch, ihr sehnlichstes Verlangen ist. Unter der Heilsperspektive, der sie sich ergeben, wird ihre irdische Heimstatt zu einem Exil, mit dem sich anzufreunden oder gar näher zu befassen, sie nicht die geringste Lust verspüren, geschweige denn, dass sie bereit wären, sich dauerhaft in es zu finden. Vielmehr hoffen sie inständig, dass es nicht lange währen und bald schon der als himmlisches Sein erstrebten wahren Wirklichkeit weichen möge.
In dem Maße freilich, wie ihre Hoffnung sich als wenn auch vielleicht nicht trügerisch, so doch überstürzt und voreilig herausstellt und die erwartete Einkehr ins Himmelreich sich verzögert und als ein eher distantes oder künftiges denn präsentes oder imminentes Ereignis erweist, müssen sich die Hoffenden nun aber doch mit der irdischen Welt, die ihnen länger erhalten bleibt als gedacht, arrangieren und im menschlichen Dasein, das bis auf unabsehbar Weiteres ihr modus vivendi bleibt, irgendwie einrichten. Das Erdenleben, dem sie nicht so rasch zu entrinnen vermögen, müssen sie mit der Heilsperspektive, unter der sie stehen, zumindest als Provisorium in Einklang bringen. Sie sehen sich der paradoxen Aufgabe konfrontiert, der irdischen Existenz, die ihnen aus heilsperspektivischer Sicht als absolut verwerflich und nichtig gilt, im Blick auf die Heilsperspektive und um ihretwillen dennoch einen Stellenwert, eine Bedeutung beizumessen. Bis zum Eintreffen des himmlischen Heils müssen sie sich mit anderen Worten in ihrem an sich mit dem Heil ebenso unvereinbaren wie unvermittelten irdischen Dasein so einrichten, dass letzteres dem ersteren zumindest nicht widerstreitet und nach Möglichkeit sogar Vorschub leistet.
Die Lösung dieser Aufgabe lautet imitatio Christi. Was sie vollbringen müssen, dafür gibt es ein Vorbild: das Leben des Herrn, der ihnen die Heilsperspektive eröffnet beziehungsweise auf sakramentalem Weg sogar schon das Heil gebracht hat und der, um dies tun zu können, ins irdische Dasein hat eintreten, Mensch hat werden müssen. Indem er den Menschen erschienen ist und in ihrer vergänglichen Scheinwelt unter ihnen gelebt hat, um ihnen den Weg zum ewigen Sein zu weisen, aus dem er kam und in das er am Ende zurückgekehrt ist, hat er ihnen vorgemacht, wie sich ein Erdenleben mit dem Eingang ins Himmelreich wenn auch vielleicht nicht in Einklang bringen, so jedenfalls doch verträglich gestalten lässt. Um diese Verträglichkeit ihres irdischen Aufenthalts mit der Heilsperspektive und der durch sie avisierten himmlischen Bleibe zu erreichen, brauchen die Menschen nichts weiter zu tun, als ihre Wahrnehmung der Welt und ihr Verhalten im Dasein am Denken und Handeln, an den Vorstellungen und Aktionen ihres Erlösers zu orientieren und auszurichten.
Wie ihr Erlöser müssen auch die, die ihm nachfolgen und durch ihn ins Himmelreich gelangen wollen, die Dinge und Reichtümer dieser Welt geringschätzen, sie nicht als an sich erstrebenswerte Objekte, sondern nur als für die einfache Subsistenz beziehungsweise für die Erbauung der Seele erforderliche materielle und spirituelle Mittel ansehen, Armut, Askese und Keuschheit, kurz, Enthaltsamkeit in jeglicher Form üben, müssen auch sie die Liebe zum Nächsten und die Verwendung für ihn über Eigennutz und das persönliche Wohl stellen, müssen auch sie in der irdischen Welt und im menschlichen Dasein ganz allgemein nichts als Wegmarken beziehungsweise Trittsteine auf dem ebenso dornenreichen wie steilen und ebenso beschwerlichen wie flüchtigen Pfad zum ewigen Leben erkennen. Seine Gleichnisse werden für sie zu Leitfäden ihrer Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen. Wie und zu welchem Ende er Mahlzeit hält, Ähren rauft, Fische fängt, Brot bricht, Händler vertreibt, Zöllnern vergibt, Kinder hochhält, Demut und Duldung beweist, Vornehmheit schmäht und Niedrigkeit erhebt – all das gewinnt Vorbildfunktion für sie und ist dazu angetan, ihre Objektvorstellungen zu prägen und ihren Umgang mit der Welt zu determinieren.
So gesehen, liefert der spät- und nachimperialen Zeit das Leben Christi mit seinen Erfahrungen, Einstellungen und Handlungen das Pendant zu jenen Archetypen und Paradigmata, die in den antiken Religionen das kultstiftende Leben der Heroen und Götter schafft. Allerdings findet sich die Entsprechung durch zwei wichtige Unterschiede modifiziert. Zum einen weisen die dem Leben Christi entnommenen Archetypen und Paradigmata nicht die gleiche Sakralität oder Sanktionsmacht auf, wie sie den durch die antiken Kulte beschworenen und bekräftigten eignet. Letztere verleihen ja einer irdischen Welt und einem menschlichen Dasein Bestand und Wirklichkeit, die ohne die archetypischen Schöpfungen der Heroen beziehungsweise die paradigmatischen Setzungen der Götter von der Indifferenz und Negativität des heimlichen Altergo und Vexierbilds der Heroen und Götter, eines toto coelo anderen Subjekts, bedroht wären und in der Tat in der dringenden Gefahr stünden, als bloßer Schein zu erscheinen und für nichts zu gelten; sie sind mit anderen Worten contra nihilum erschaffen und gesetzt, sind der feste Boden über einem bodenlosen Abgrund, sind das Sein, das mit der Verdrängung des Nichts, das es in sich birgt, steht und fällt.
Die christliche Gottheit hingegen ist dieses andere Subjekt, dieses abgründige Alterego der opferkultlichen Götter, nur dass seine Indifferenz und Negativität mit messianisch-platonischen Mitteln in eine bei aller ontologischen Differenz doch als Alternative zum Schein des irdischen Daseins, als Sein, erscheinende Positivität und aller chronologischen Transzendenz zum Trotz im Prinzip ebenso schaubare wie erreichbare Wirklichkeit umgewandelt ist! Und nur dass diese in ihrem substanziellen Sein und ewigen Bestehen die irdische Welt als vergänglichen Schein und das menschliche Dasein als flüchtiges Nichts erweisende Gottheit per medium ihres eingeborenen Sohns, des Messias, den Menschen den Weg weist beziehungsweise das Mittel an die Hand gibt, aus dem irdischen Schein in ihr himmlisches Sein hinüberzugelangen, ihr flüchtiges Dasein gegen das ewige Leben einzutauschen! Und dass mehr noch und zu allem Überfluss die Gottheit durch das Menschsein des von ihr gesandten Sohnes und Erlösers, durch ihn als Menschensohn, den Menschen vorführt, wie man sich auf Erden verhält und, wie auch immer vorübergehend, wie auch immer in Erwartung des Auszugs aus der Welt und Einzugs ins Himmelreich, einrichtet!
Dies letztere, diese zur Nachahmung einladende Vorführung, wie man sich zwischenzeitlich auf Erden verhält und einrichtet – sie resultiert in stereotypen Wahrnehmungsweisen und vorbildlichen Verhaltensformen, in allgemeingültigen Objektbeziehungen und verbindlichen Praktiken, die zwar durchaus den kultisch fixierten Archetypen und rituell fixierten Paradigmata der alten Religionen entsprechen und eine ähnliche Funktion wie diese erfüllen, die aber im Unterschied zu ihnen nicht contra nihilum, als Bollwerk gegen eine durch die Religion verdrängte Negativität, sondern gratia dei, als Konzession der ihre Negativität gnädigerweise mit dem Aufenthalt in der nichtigen irdischen Sphäre verträglich machenden christlichen Gottheit bestehen.
Und weil diese den irdischen Lebenswandel vor dem Eintritt ins ewige Leben organisierenden, diese wenn schon nicht wegweisenden, so jedenfalls doch den Weg ins Himmelreich offen haltenden Archetypen und Paradigmata ein Gnadenakt und Gottesgeschenk, ein im Menschsein, im Erdenwandel des Gottessohnes gemachtes Zugeständnis der die irdische Welt für nichts und Schein erklärenden Gottheit an das menschliche Dasein in der irdischen Welt sind, statt die Schöpfung und Setzung der alten Götter zu sein, die damit um jeden Preis die unbedingte Indifferenz und absolute Transzendenz ihrer eigenen wahren Natur zu kaschieren und aus der Welt zu schaffen und der Welt selbst ihr Sein zu erhalten und Wirklichkeit zu vindizieren gedacht sind, weisen sie nun auch weit weniger den aller Verdrängung beziehungsweise Umfunktionierung eigenen Zwangscharakter und reaktiven Klappmechanismus auf und sind weit weniger ritualisiert oder habituell fixiert, sind der Modifikation durch Erfahrung, der Anpassung an vorgefundene Verhältnisse beziehungsweise neue Herausforderungen entschieden leichter zugänglich.
Im Unterschied mit anderen Worten zu den in den antiken Kulten beschworenen und sanktionierten archetypischen Wahrnehmungskategorien beziehungsweise paradigmatischen Ritualformen schließen die dem Leben Christi entnommenen und als vorbildlich akzeptierten Objektbestimmungen beziehungsweise als prototypisch imitierten Verhaltensweisen Veränderungen und Umgestaltungen nach Maßgabe des Wandels, dem die irdische Lebenswelt und das menschliche Dasein unterworfen sind, ganz und gar nicht aus; jedenfalls beweisen sie solch historischem Wandel nicht die Trägheit und Widersetzlichkeit, mit der jene ihm begegnen, sondern krönen das Gottesgeschenk, das sie sind, die herrlich offenbare Gnade des schrecklich verborgenen Gottes, die sie darstellen, durch die Bereitwilligkeit, mit der sie sich zunehmend irdischeren Interessen und weltlicheren Absichten bis zur Unkenntlichkeit anpassen.
Und zweitens gründen die der christlichen Religion in genere und dem Leben Christi in specie entlehnten archetypischen Objekbestimmungen und paradigmatischen Verhaltensweisen auch nicht, wie bei den der antiken Religion entspringenden Archetypen und Paradigmata der Fall, in jener als agrargesellschaftlich-territorialherrschaftlich definierten besonderen Sozialformation, aus der sich die handelsstädtisch-marktwirtschaftliche Gemeinschaft mit List und Tücke erst herausarbeiten und befreien und der gegenüber sie sich als eine grundlegend andere Sozialformation etablieren und behaupten muss.
Weil vielmehr die christlichen objektiven Wahrnehmungsformen und intersubjektiven Verhaltensweisen letztlich das Resultat der zum Imperium hypertrophierten Handelsstadt sind, die die alten Territorialherrschaften in Konkurs treibt und dabei sich selber um ihre Grundlage bringt und ruiniert, sind sie nicht durch eine bestimmte Sozialformation hervorgebracht und an diese gebunden, sondern sind vielmehr Wahrnehmungsdirektiven und Handlungsanweisungen, die unabhängig von aller irdischen Befindlichkeit und abstrakt von aller politisch-ökonomischen Verfassung jedem zur Verfügung stehen, der, von der Welt fundamental enttäuscht und zur Weltflucht entschlossen, nach dem Himmelreich strebt und deshalb das menschliche Dasein, den Wandel auf Erden als bloßen Zwischenaufenthalt, bloßes Intermezzo begreift, als einen Durch- und Übergang, der zwar, weil er seine unverhofft eigene Dauer hat, länger währt als gedacht, das Gesellschaftstier Mensch zwingt, sich sozialformativ zu organisieren, und zu diesem Zweck kollektive Allgemeingültigkeit gewährleistende Objektivierungen und kommunale Verbindlichkeit schaffende Orientierungen erforderlich werden lässt, der aber zugleich macht, dass diese die Wahrnehmung bestimmenden Objektivierungen und das Verhalten leitenden Orientierungen durch einen prinzipiell distanzierten Umgang mit der irdischen Welt insgesamt und eine wesentlich reservierte Einstellung zum menschlichen Dasein als solchem ausgezeichnet und denkbar weit entfernt davon sind, sich einem spezifischen sozialformativen Organisationsmodell beziehungsweise einer besonderen politisch-ökonomischen Lebensweise verbunden oder verpflichtet zu zeigen.
Das hindert zwar nicht, dass in dem Maße, wie die nachimperialen Gesellschaften auf der Erde wieder festen Fuß fassen und das zuerst und primär im Modus einer Wiederaufnahme alter, territorialherrschaftlicher Verhältnisse tun, sprich, in der modifizierten Gestalt der Feudalgesellschaft die einstigen agrarisch-fronwirtschaftlichen Herrschaftsstrukturen wiederaufleben lassen – dass in dem Maße also, wie dies geschieht, die Wahrnehmungsmodi und Verhaltensweisen eine der Sozialformation entsprechende Färbung annehmen und durch bäuerliche beziehungsweise adlige Erfahrungen und Handlungen geprägt erscheinen. Wohl aber bleibt ausgeschlossen, dass diese der feudalen Gesellschaft eigenen Erfahrungen und Handlungen die kollektive Wahrnehmung und das kommunale Verhalten so völlig durchdringen und von deren Kategorien beziehungsweise von dessen Modalitäten so exklusiv Besitz ergreifen, dass andere Erfahrungen und Handlungen, wie sie die zu neuem Leben erwachende kommerzielle Funktion und das mit ihr einhergehende System handelsstädtischer Produktionsgemeinschaften mit sich bringen, quasi aus dem Spektrum der feudal geprägten Wahrnehmungskategorien und Verhaltensweisen herausfallen und in schroffen Gegensatz zu ihnen treten und also wie die handelsstädtischen Gemeinschaften in der Antike einen Paradigmenwechsel und epistemologisch-verhaltenspraktischen Bruch bewirken, der die Kontinuität zwischen handelsstädtischer Gemeinschaft und territorialherrschaftlicher Gesellschaft zu sprengen und der ersteren selbst die von der letzteren tradierten und gleichermaßen für den Umgang mit der Objektwelt und die innergesellschaftliche Praxis maßgebenden Wahrnehmungsformen und Verhaltensweisen zu verschlagen droht.
Durch die weltflüchtige Heilsperspektive, die christliche Erlösungshoffnung zum bloß gratia dei zur Verfügung stehenden weltlichen Notbehelf oder zwischenzeitlichen Provisorium relativiert und deshalb frei von dem kultischen Starrsinn und der rituellen Unverbrüchlichkeit, die den contra nihilum aufgebotenen Archetypen und Paradigmata der antiken Religionen eignen, mögen diese Wahrnehmungsformen und Verhaltensweisen noch so sehr gefärbt von der als erste sich retablierenden territorialherrschaftlich-fronwirtschaftlichen Lebensweise und angepasst an sie sein, sie lassen doch allemal Raum für die Sicht- und Verhaltensweisen neuer Formen der Vergesellschaftung wie der handelsstädtisch-marktwirtschaftlichen und gewährleisten durch ihre das irdische Leben und das menschliche Dasein grundsätzlich relativierende und, wenn nicht zum vergänglichen Schein, so jedenfalls doch zum kursorischen Phänomen erklärende Transzendenz oder heilsperspektivische Fluchtpünktlichkeit, dass beide Weltanschauungen und Lebenspraktiken, die der territorialen und die der kommunalen Sozialformation, in ihrem perspektivischen Rahmen bleiben und als Variationen eines gemeinsamen Themas weit entfernt davon sind, sich der Tendenz nach wechselseitig zu negieren und auszuschließen, und vielmehr ohne Mühe koexistieren beziehungsweise kohabitieren können.
Und das ist auch gut so, denn schließlich entsteht anders als in der Antike das handelsstädtische Marktsystem nicht an der Peripherie der territorialherrschaftlichen Sphäre, sondern in deren Mitte und verhalten sich die beiden Formationen nicht als selbständige politische Einheiten zu- und gegeneinander, sondern sind politisch und ökonomisch fest miteinander verschränkt, in einem symbiotischen Verhältnis, in dem die marktwirtschaftliche Handelsstadt der fronwirtschaftlichen Territorialherrschaft ökonomische und strategische Vorteile bringt und dafür von der Territorialherrschaft, der sie untertan und deren Herrschaftsgebiet sie formell eingegliedert ist, mit umfassender militärischer Protektion und weitgehender politischer Freiheit belohnt wird. Unter den Bedingungen dieser gleichermaßen räumlich und gesellschaftlich engen Symbiose, zu der sich in der mittelalterlichen Feudalgesellschaft Handelsstadt und Territorialherrschaft zusammengeschlossen zeigen, hätte es offensichtlich fatale Folgen, wenn die neue städtisch-marktwirtschaftliche Lebensform mit ihren Kategorien und Praktiken der alten agrarisch-fronwirtschaftlichen so schroff entgegenstünde, dass sie die letztere kurzerhand verdrängte und ersetzte, statt sich in sie einzufügen und sie bloß zu ergänzen.
Dass es zu einer solch schroffen Entgegensetzung, einem solchen tendenziellen Ausschlussverhältnis nicht kommt, gewährleistet wie gesagt der heilsgeschichtliche Rahmen, in dem alle Kategorialität und Praxis, alle Anschauung der Welt und alles gesellschaftliche Verhalten stehen. Sub specie aeternitatis oder, weniger pauschal formuliert, unter dem Signum der christlichen Botschaft vom Ende der irdischen Welt und vom Eintritt ins Himmelreich verlieren die differenten Sozialformationen und die dazugehörigen Lebensformen ihren Ausschließungscharakter. Beide beziehen sich in ihrer Wahrnehmung der Objektivität und in ihrem Umgang mit der Welt beziehungsweise ihrem Verhalten in der Gesellschaft auf dieselben gratia dei ihnen verfügbaren und im Erdenwandel des Gottessohnes Gestalt gewordenen Sichtweisen und Handlungsformen, und ob diese eher durch adliges Kriegshandwerk und bäuerliche Landbestellung oder durch kommerziellen Austausch und handwerkliche Materialbearbeitung modifiziert und im Sinne einer Anpassung an die jeweiligen materialen Erfordernisse und realen Erfahrungen geprägt sind, macht zwar einen Unterschied, aber keinen, der einen ausschließenden Gegensatz begründen und nicht vielmehr Raum für ein Komplementärverhältnis bieten könnte.
Der Kommerz und die ihm marktwirtschaftlich zuarbeitenden Produktionsgemeinschaften beziehen sich im systematischen Prinzip, wenn auch vielleicht nicht in der historischen Abfolge ebenso unmittelbar wie die Feudalherrschaft und ihre fronwirtschaftlich-bäuerlichen Untertanen auf die christologisch sanktionierten Sicht- und Verhaltensweisen, und deshalb kann sich ein Gefühl der Entfremdung und Abstoßung, wie es die handelsstädtische Gesellschaft der Antike angesichts der definitiv dem territorialherrschaftlich-agrarischen Kontext eingeschriebenen und ihm von Haus aus zugehörigen sakralen Archetypen und rituellen Paradigmata befällt, hier gar nicht einstellen. Weil hier der Typus und das Paradigma von Haus aus heilsperspektivisch vermittelte und aufgehobene Momente sind und nämlich einer die Welt in ihren sämtlichen Erscheinungen ebenso sehr letztlich negierenden wie vorübergehend tolerierenden und das menschliche Dasein in allen seinen Ausprägungen ebenso unbedingt transzendierenden wie bedingt sanktionierenden Fluchtbewegung entstammen, sind die durch Kampf und Fron, sprich, durch die territoriale Herrschaft, dem heilsperspektivischen Typus und christlichen Paradigma aufgepfropften Modifikationen und Anpassungen nicht weniger sekundär und abgeleitet, als jene es sind, die Handel und Austausch, sprich, der kommerzielle Markt, den christologischen Sicht- und Handlungsweisen abverlangen, sind mit anderen Worten die ersteren ebenso heteronom und vermittelt wie die letzteren.
Deshalb aber erübrigt sich hier jener eigentümliche Vermittlungs- und Adaptionsprozess, zu dem sich in der Antike das handelsstädtische Marktsystem gezwungen sieht. Weil es von sich aus über keine das zivile Leben bestimmenden und regelnden allgemeingültigen Vorstellungsformen und verbindlichen Verhaltensweisen verfügt und diese vielmehr als originale Errungenschaft und integrierenden Bestandteil der territorialherrschaftlichen Agrargesellschaft vorfindet, der es im Doppelsinn von Herkunft und Ablösung entspringt, muss in der Antike die Handelsstadt bemüht sein, dem territorialherrschaftlichen Zusammenhang diese von ihm religiös monopolisierten und nämlich kultisch gepflegten beziehungsweise rituell reaffirmierten Vorstellungsformen und Verhaltensweisen zu entreißen und in wenn auch nicht der Religion überhaupt entzogene und radikal säkularisierte, so doch aber den weltlichen Interessen und irdischen Belangen der handelsstädtischen Marktgesellschaft angepasste, sprich, durch das innerstädtische Leben und seine Mechanismen vermittelte und darauf gemünzte Wahrnehmungsmodelle und Verhaltensmuster zu überführen. Mit anderen Worten, die antike Handelsstadt muss die dem territorialherrschaftlichen Kontext exklusiv eingeschriebenen Archetypen der Objektwahrnehmung und Paradigmata des Umgangs mit und in der Welt ihrem ursprünglichen religiösen Grund und Boden entziehen und durch Umfunktionierung der olympischen Götter in Repräsentationsfiguren der Handelsstadt und Umrüstung ihrer territorialen Kulte in Selbstvergewisserungsveranstaltungen der Polis als pro forma ihrer Herkunft zwar nach wie vor religiös fundierte, pro materia ihrer nunmehrigen Funktion aber säkular konstituierte Objektbestimmungen und Handlungsformen neu zur Geltung bringen.
Kurz, sie muss die oben als Stilisierung des Sakralen oder Ästhetisierung des Kultischen beschriebene eigentümliche Leistung erbringen, die ursprünglich gegen die Entrealisierung und Disqualifizierung der irdischen Welt und des menschlichen Daseins, die von einem transzendent anderen Subjekt her droht, aufgebotenen kultischen Archetypen und Paradigmata in – ungeachtet ihrer beibehaltenen kultischen Fasson – vielmehr ästhetische Modelle und Muster zu transformieren, deren immanente Aufgabe es ist, der Gefahr einer Partikularisierung der Wahrnehmung und Auflösung des Verhaltens zu wehren, die das Kollektivsubjekt selbst, das Gattungssubjekt Polis heraufbeschwört, indem es durch seine marktwirtschaftliche Verfassung und Organisation die alten, als Typus oder Paradigma firmierenden gesellschaftlichen Anschauungsformen und Handlungsweisen außer Kraft und die ebenso beschränkte wie abstrakte neue Identität des Wertes oder Pretium an ihre Stelle setzt.
Für die mittelalterliche Handelsstadt und ihre marktbezogene Produktionsgemeinschaft hingegen erübrigt sich diese als Ästhetisierung apostrophierte Transformation der kraft Religion gegebenen archetypischen Kategorien und paradigmatischen Rituale in – dem städtischen Leben und kommerziellen Treiben angepasste – säkulare Wahrnehmungsmodelle und Verhaltensmuster, weil die ersteren anders als in der Antike keine einem ebenso konkreten wie bestimmten Daseins- und Vergesellschaftungsmodus eingeschriebenen Kodifizierungen, sondern ebenso abstrakte wie aufs Jenseits orientierte Dispositionen sind, die, dem weltflüchtigen Leben des Erlösers entlehnt, im Gegenteil allen, egal ob territorialherrschaftlich-fronwirtschaftlichen oder handelsstädtisch- marktwirtschaftlichen Lebens- und Vergesellschaftungsformen gleich fern stehen und sie dem gleichen heilsperspektivisch-radikalen Vorbehalt unterwerfen, damit aber auch alle der gleichen gratia dei gewährten Anerkennung oder Duldung teilhaftig werden lassen und erlauben, sie, die der weltflüchtigen Vita Christi entlehnten Archetypen und Paradigmata, fürs erste und vorläufig so zu modifizieren und anzupassen, dass sie mit dem jeweils für den Aufenthalt auf Erden gewählten und ausgebildeten Daseinsmodus vereinbar werden und unter Wahrung ihres pro forma normativen und regulativen Charakters pro materia des ausgebildeten Daseinsmodus eine schier unerschöpfliche Flexibilität und Plastizität beweisen.
Dass es trotz fehlender handelsstädtischer Amphibolie auch in der nachimperialen Zeit zu einer die religiöse Einbindung der Archetypen und Paradigmata sprengenden Ästhetik, ihrer Überführung in säkulare Wahrnehmungsmodelle und Verhaltensmuster kommt, ist der die Neuzeit heraufbeschwörenden handelsstädtischen Entwicklungsdynamik geschuldet. Diese Entwicklungsdynamik liegt letztlich in der fundamental differenten Perspektive der die gesellschaftliche Reproduktion Betreibenden einerseits und der sie Organisierenden andererseits, also der Produzenten und der Handeltreibenden beschlossen, wobei konstitutiv für die Perspektive der letzteren das allgemeine Äquivalent, das Geld, ist.
Unter dem gemeinsamen Dach der heilsperspektivischen Wahrnehmungsformen und Verhaltensweisen, die die den Weg heraus aus dem irdischen Jammertal und hinüber ins Himmelreich weisende Vita Dei liefert, etabliert sich die handelsstädtisch-marktwirtschaftliche Gemeinschaft als eine ebenso religiös fundierte und sanktionierte Sozialisationsform wie die territorialherrschaftlich-agrarwirtschaftliche Gesellschaft. Und deshalb bleibt ihr jene die religiöse Fundierung zwar nicht abschaffende, aber doch aufhebende Umfunktionierung des Göttlichen und Umrüstung seiner Präsenz, jene Transformation der die Welt ihres Seins und das Dasein seiner Wirklichkeit versichernden Religion in eine dem Bewusstsein seine Allgemeingültigkeit und dem Handeln seine Verbindlichkeit vindizierende Kunstreligion, kurz, jene Überführung der Theologie in Ästhetik erspart, zu der sich in der Antike die handelsstädtisch-marktwirtschaftliche Gemeinschaft angesichts der Tatsache gezwungen findet, dass die vorhandenen archetypischen Wahrnehmungskategorien und paradigmatischen Ritualformen konstitutionell verknüpft sind mit der territorialherrschaftlich-agrarwirtschaftlichen Gesellschaft, der sie, die marktwirtschaftliche Gemeinschaft, im Doppelsinn von Herkunft und Ablösung entspringt.
Dennoch kommt es auch in der nachimperialen Zeit, beim Übergang nämlich vom so genannten Mittelalter zur Neuzeit, zu einer dem antiken Verfahren vergleichbaren ästhetischen Neufassung und Umarbeitung der bis dahin religiös fundierten, als quasi sakrale Setzung und rituelle Praxis sanktionierten Sicht- und Verhaltensweisen – allerdings nicht aufgrund eines zum förmlichen Ausschließungsverhältnis geratenden Gegensatzes zwischen den im Gegenteil unter dem gemeinsamen Dach der heilsperspektivischen Weltsicht und Lebensführung gedeihlich und halbwegs verträglich kohabitierenden Sozialformationen, sondern vielmehr infolge der den traditionellen Rahmen jener religiösen Sicht- und Verhaltensweisen zu sprengen drohenden Entwicklungsdynamik, den die eine der beiden Sozialformationen, die handelsstädtisch-marktwirtschaftliche Gemeinschaft, aus eigenem Antrieb und ganz für sich allein entfaltet. Jener handelsstädtischen Entwicklungsdynamik nämlich wohnt eine Triebkraft inne, die sich in ihrer Exzentrik und ihrer den irdischen Erscheinungen bezeigten Negativität wie ein Vexierbild der christlichen Weltfluchtmotion, des Strebens nach dem Himmelreich, ausnimmt und die in dieser ihrer vexierbildlichen Affinität zur heilsperspektivischen Konstitution der nachimperialen Gesellschaften die letztere nicht zwar gleich in toto der christlichen Existenz, wohl aber in parte des weltlichen Daseins zu verdrängen und nicht zwar vielleicht de jure des kirchlichen Glaubens, wohl aber de facto des gesellschaftlichen Handelns zu ersetzen Miene macht.
Hort und Quelle dieser Triebkraft ist die vom Markt den Dingen verliehene und als Wert oder Pretium bestimmte neue Identität, jenes den Objekten kommerziell vindizierte Anderssein, das ihnen erlaubt, sich gegen Anderes auszutauschen, Anderes zu werden, ohne dabei sich selbst zu verlieren, und das in seiner in sich reflektierten, als die neue Sichselbstgleichheit realisierten Gestalt das allgemeine Äquivalent, das Geld ist. Diese marktspezifische, als Wert oder Pretium bestimmte neue Identität der Dinge hat auch in der Antike bereits zwei – abhängig von dem gesellschaftlichen Subjekt, das sie wahrnimmt – ganz verschiedene Aspekte oder, besser gesagt, Gesichter.
Für diejenigen, die Dinge für den Markt produzieren, für die als Lieferanten für den Markt tätigen Subjekte also, besteht der Wert der Dinge eben in ihrer Austauschbarkeit, darin, dass sie sich per Austausch in andere, für den, der sie austauscht, nützliche Dinge verwandeln können. Für diejenigen hingegen, die den Markt betreiben, die die gelieferten Dinge mittels Markt zirkulieren lassen, ist der Wert eine Art Selbstzweck, quasi ein Wert an sich. Ihnen geht es nicht um andere, nützliche Dinge, die sich gegen das auszutauschende Ding aufgrund und nach Maßgabe seines Wertes eintauschen lassen, sondern einzig und allein darum, durch den Austausch in den Besitz des Wertes als solchen zu gelangen, im Ergebnis des Austauschs den Wert sans phrase in Händen zu halten. Den Wert sans phrase, will heißen, ihn in der erwähnten, zur realen Sichselbstgleichheit gebrachten Gestalt als allgemeines Äquivalent, Geld. Ist es den Marktbetreibern gelungen, die materialen Güter, die sie vermarkten, gegen Geld auszutauschen, so haben sie das Ziel ihres kommerziellen Handelns erreicht, den Zweck des von ihnen betriebenen Marktunternehmens erfüllt.
Völlig verschiedene Intentionen also verbinden diejenigen, die die Dinge zu Markte tragen, und diejenigen, die sie vermarkten, mit der als Wert bestimmten Identität, die der Markt den Dingen zuerkennt und beimisst. Während die ersteren mittels des Werts der Dinge andere Dinge von entsprechendem Wert erstehen wollen, wollen die letzteren mittels des Werts der Dinge nichts weiter als eben diesen Wert in seiner verselbständigten Gestalt als allgemeines Äquivalent, in der zum eigenen Ding gewordenen Geldform erwerben. Und was haben die Marktbetreiber davon, was bringt ihnen diese Verwandlung von Wert in Gütergestalt in Wert in Geldform?
Was den Produzenten die von ihnen per Austausch angestrebte Verwandlung von Wert verkörpernden Gütern gegen Güter von entsprechendem Wert bringt, liegt auf der Hand: Sie bringt ihnen den praktischen oder materialen Nutzen, den die Güter, die sie eintauschen, für sie haben, während die Güter, die sie zum Austausch dafür hingegeben, entweder keinen Nutzen für sie haben oder jedenfalls gegenwärtig nicht gebraucht werden, entbehrlich sind. Die Produzenten gewinnen also mit den Dingen, die sie mittels der Dinge, die sie zu Markte tragen, auf dem Markt erstehen, für ihre Subsistenz, ihr leiblich-geistiges Leben Erforderliches beziehungsweise Dienliches.
Was aber gewinnen die Marktbetreiber, wenn sie mittels der Dinge, die sie vermarkten, Wert sans phrase, den dinglichen Wert in Geldform erwerben? Sie gewinnen mehr Wert, akkumulierten Wert, Wert, der als in die Geldform überführter den in den Dingen verkörperten quantitativ übersteigt. Dies Mehr an Wert verschafft den Marktbetreibern dabei die Funktion, die sie im Rahmen der Bemühungen der Produzenten erfüllen, sich mittels der von ihnen produzierten Dinge andere, zum Leben notwendige beziehungsweise dienliche Dinge zu besorgen. Tatsächlich sind ja die unterschiedlichen Intentionen, die Produzenten und Marktbetreiber mit dem Wert und dem auf ihm aufbauenden kommerziellen Austausch verbinden, keine getrennt und unabhängig voneinander zu verfolgenden Absichten, sondern sind Bestrebungen, die sich nur durch- und miteinander zum Erfolg führen, Vorhaben, die sich nur in Wechselwirkung und im Verein verwirklichen lassen.
Marktsystematisch betrachtet, verhalten sich das Vorgehen der Produzenten und das Verfahren der Marktbetreiber wie Glieder einer Kette, wie zusammenhängende und ineinandergreifende Momente eines durchgängigen Prozesses. Wenn die Produzenten ihre Produkte zu Markte tragen, dann treffen sie dort nur im Ausnahmefall auf die Produkte, die sie dafür eintauschen wollen. Statt auf diesen unwahrscheinlichen Fall zu bauen, tauschen sie bei den Marktbetreibern ihre Produkte gegen allgemeines Äquivalent, Geld, ein. Das hat für sie den Vorteil, dass sie, weil ja das Geld als sichselbstgleich verkörperter Wert definitionsgemäß allgemeines Äquivalent, das heißt, ein Ding ist, das jederzeit und überall als Gegenwert für Güter jeglicher Art, für alle als Wertverkörperungen geltenden Produkte akzeptiert wird, imstande sind, zu anderer Zeit beziehungsweise an anderem Ort die Dinge einzutauschen, die sie hier und jetzt nicht oder höchstens ausnahmsweise erstehen können.
Den Vorteil, den die Marktbetreiber den Produzenten verschaffen, indem sie ihnen ihre Produkte abnehmen und ihnen allgemeines Äquivalent dafür geben, das dann die Produzenten wiederum gegen Produkte austauschen können, die sie brauchen und die die Marktbetreiber anderen Produzenten abgekauft haben – diesen Vorteil einer ebenso zuverlässigen wie umfassenden Versorgung mit Subsistenzmitteln, den die Produzenten aus der Vermarktung ihrer zu Markte getragenen Produkte ziehen, ihn lassen sich die Marktbetreiber in der Weise honorieren, dass sie einen Teil des Werts der von den Produzenten zu Markte getragenen Produkte diskontieren, um ihn dann beim Verkauf der vermarkteten Produkte an die Produzenten als quasi den Anteil des Marktes, als ihnen, den Marktbetreibern, zufallenden Gewinn, zu realisieren. Sie nutzen den Vermarktungsvorgang, um an dem von den Produzenten geschaffenen Güterwert zu partizipieren, sich einen Teil davon als ihren Anteil anzueignen.
Und das Vehikel, mittels dessen sie das tun, ist das allgemeine Äquivalent, das Geld, das als Münze des Marktes, als katalytisches Ferment des Austauschs den Vermarktungsvorgang überhaupt ermöglicht, insofern es zum ersten dazu dient, den ihre Produkte zu Markte tragenden Produzenten diese abzukaufen, und dann aber zum zweiten gebraucht wird, um diese vom Markt gekauften Produkte den als Konsumenten an ihnen interessierten Produzenten wieder zu verkaufen. Weil das allgemeine Äquivalent den Gesamtprozess vermittelt, sprich, ihn in zwei getrennte Austauschakte auseinanderlegt, in denen es jeweils als Gegenwert fungiert, ist es der natur- oder vielmehr kulturgegebene Ort, wo die Aneignung des Marktanteils am Produktwert durch die Marktbetreiber stattfindet.
Dabei ist der erste Akt des kommerziellen Gesamtaustauschs, der Austausch der zu Markte getragenen Produkte gegen in Marktbetreibershand befindliches allgemeines Äquivalent, der Ort, an dem besagte Diskontierung stattfindet, indem nämlich die Marktbetreiber den Produzenten für ihr Produkt weniger Gegenwert in Form von allgemeinem Äquivalent überlassen, als dem Produktwert eigentlich entspricht oder äquivalent ist. Und der zweite Akt des Gesamtaustauschs, der Austausch der vermarkteten Produkte gegen das allgemeine Äquivalent, das sich nun in der Hand der als Konsumenten den Markt aufsuchenden Produzenten befindet, ist der Ort, an dem sich die Realisierung des von den Marktbetreibern angeeigneten Wertteils vollzieht, weil jetzt die letzteren den als Konsumenten auftretenden Produzenten das Produkt, das diese begehren, zu einem Gegenwert in Form von allgemeinem Äquivalent abtreten, der dem Produktwert tatsächlich entspricht, im Sinne des Wortes äquivalent, gleichwertig, ist.
Dank des mittels allgemeinem Äquivalent, Geld, der Münze des Marktes abgewickelten Austauschs von Produkten, die die Produzenten nicht brauchen oder überschüssig haben und deshalb zu Markte tragen, gegen Produkte, die sie brauchen und auf dem Markt finden beziehungsweise von ihm beziehen, stehen also die Marktbetreiber am Ende des Austauschvorganges mit mehr Wert als zu Anfang da. Der geldvermittelte Austauschprozess ermöglicht den Marktbetreibern, sich einen Teil des Werts der von ihnen vermarkteten, nach ihrer Maßgabe ausgetauschten Produkte anzueignen, ermöglicht ihnen mit anderen Worten, Mehrwert zu akkumulieren. Dabei wird deutlich, dass die Rede von einem Mehrwert nur auf der Basis dieser geldvermittelten, eben kommerziellen, Transaktion einen Sinn gewinnt, dass Mehrwert nur auf Grund dieses marktspezifischen Mechanismus eines durch das allgemeine Äquivalent in zwei scheinbar voneinander unabhängige Akte aufgespaltenen Austauschvorganges existiert. Nur weil im ersten Akt, dem Einkauf des Produktes, die Marktbetreiber den Produzenten weniger allgemeines Äquivalent geben, als das Produkt wert ist, können sie nach dem zweiten Akt, dem Verkauf des Produkts, mehr Wert in Form von allgemeinem Äquivalent ihr eigen nennen als zuvor.
Insofern bedarf es nun auch einer Richtigstellung unserer obigen unbedachten Formulierung, dass am Ende der von den Marktbetreibern betriebenen Vermarktung der von den Produzenten zu Markte getragenen Dinge deren in die Geldform überführter und als solcher realisierter Wert den in den Dingen verkörperten Wert quantitativ übersteige. Die durch die Formulierung suggerierte Vorstellung, als habe die bloße Überführung des Werts aus seiner dinglichen Gestalt in die Geldform diesen Effekt, ihn zu vermehren, ist irreführend und schlichtweg falsch. Nicht der in den Dingen verkörperte Wert erfährt durch den zweiten Akt des Austauschvorganges eine Vermehrung, sondern der von den Marktbetreibern im ersten Akt des Austauschvorganges in Form von Geld in die Dinge investierte Wert zeigt sich vermehrt. Und im Ergebnis des zweiten Akts des Austauschvorganges vermehrt kann sich der im ersten Akt in die Dinge investierte Wert einzig und allein deshalb zeigen, weil er in jenem ersten Akt in entsprechend verminderter Menge investiert wurde, weil er als der in Geldform gegen die Dinge ausgetauschte Wert unter deren tatsächlichem Wert lag, ihnen nicht gleichwertig war.
Und eine weitere Richtigstellung scheint hiernach am Platze, betreffend unsere obige Rede von den ganz verschiedenen Aspekten oder Gesichtern, die die als Wert bestimmte Identität der Dinge für Produzenten und Marktbetreiber jeweils habe, und von den entsprechend verschiedenen Intentionen oder Zwecken, die Produzenten und Marktbetreiber jeweils mit dieser Identität der Dinge verfolgten. Wenn damit suggeriert werden soll, dass Produzenten und Marktbetreiber im Wert ihre verbindliche Operationsbasis, ihren gemeinsamen Ausgangspunkt haben und erst in der Absicht, die sie mit diesem Ausgangspunkt verknüpfen, beziehungsweise in der Funktion, die sie ihm zuweisen, divergieren, so ist auch diese Darstellung, wie deutlich geworden sein dürfte, irreführend und regelrecht falsch.
Für die Produzenten nämlich ist der Ausgangspunkt das materiale Produkt, das sie zum Zweck ihrer Subsistenz schaffen und das, weil in einer arbeitsteilig-kooperativ strukturierten Gesellschaft wie der menschlichen das Subsistenzerfordernis nicht ohne Teilhabe an den Produkten anderer, sprich, nicht ohne Austausch zwischen den Produzenten, zu erfüllen ist, als das die soziale Gerechtigkeit in der Distribution der Produkte gewährleistende Maß des Austauschs den Wert ins Spiel bringt, der durch diese seine Funktion als Tauschwert bestimmt ist.
Für die Marktbetreiber hingegen ist der Ausgangspunkt nicht das materiale Produkt, sondern nur und ausschließlich sein Wert, er freilich nicht bloß als der im Produkt steckende Tauschwert, sondern je schon als ein unabhängig von ihm existierendes Corpus, als allgemeines Äquivalent, Geld. Kommerzieller Austausch in genere und der Marktmechanismus in specie implizieren konstitutionell die Existenz des als allgemeines Äquivalent Gestalt gewordenen Werts, seine eigenständige Realität als Geld. Könnten die Produzenten jeweils unmittelbar mit ihresgleichen in Austausch treten, will heißen, im Austausch gegen die Produkte, die sie produzieren, aber nicht benötigen, bei ihresgleichen die Produkte erwerben, die sie benötigen, aber nicht selber produzieren, sie brauchten zwar ein wie immer geartetes Maß des Austauschs, einen Tauschwert, aber eines Vermittlers, eines den Austausch prozessual abwickelnden Maklers, kurz, eines Handeltreibenden beziehungsweise – nach der Institutionalisierung des Austauschs als Markt – eines Marktbetreibers bedürften sie nicht. Der Handeltreibende oder Marktbetreiber kommt nur ins Spiel, weil in der Empirie der unmittelbare Austausch die Ausnahme bildet und weil im Normalfall das produzierte Ding und das benötigte Produkt räumlich oder zeitlich auseinanderfallen, an verschiedenen Orten existieren beziehungsweise nicht zum gleichen Zeitpunkt vorhanden sind. Diese räumliche Differenz zu überbrücken und diese Ungleichzeitigkeit auszugleichen, dienen die kommerziellen Funktionäre, die als Händler oder Marktbetreiber tätigen Vermittler.
Die Differenz zu überbrücken oder die Ungleichzeitigkeit auszugleichen aber gelingt ihnen dank eines Stellvertreterobjekts für das benötigte Produkt, das aus Gründen räumlicher Verschiedenheit oder wegen Ungleichzeitigkeit abwesend oder nicht vorhanden ist und das deshalb nicht unmittelbar, nicht hier und jetzt, gegen das präsente und vorhandene überschüssige Ding eingetauscht werden kann. Das Stellvertreterobjekt repräsentiert das zu Markte getragene Produkt, das die Marktbetreiber den zwecks Vermarktung von ihnen versammelten Produkten beigesellt, bis an den Ort, wo, beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt, da der Produzent dem Produkt begegnet, das er benötigt und als Konsument begehrt.
Oder vielmehr repräsentiert das Stellvertreterobjekt, da es ja um den Austausch der Produkte geht und für den Austausch nicht die Produkte in ihrer materialen Beschaffenheit, sondern ihr Tauschwert maßgebend ist, diesen Tauschwert des zu Markte getragenen Produkts und macht ihn gegenüber dem benötigten Produkt, wo und wann immer dieses auftaucht, geltend. Es macht ihn geltend – das heißt, es tauscht sich so, wie es zuvor gegen das zu Markte getragene Produkt eingetauscht wurde, jetzt gegen das auf dem Markt vorgefundene benötigte Produkt wieder aus. Und zwar tut es dies nach dem um der sozialen Gerechtigkeit willen für den Austausch verbindlichen Äquivalenzprinzip, dem Prinzip, dass die zum Austausch kommenden Tauschwerte einander entsprechen, gleichwertig, eben äquivalent sein müssen.
Das Stellvertreterobjekt ist der verselbständigte, mit einer eigenen Gestalt begabte Tauschwert, der unverkleidete Tauschwert, Wert sans phrase, der überall dort überbrückend oder ausgleichend einspringt, sich überall dort vermittelnd einschaltet, wo vom Produzenten geliefertes Ding und von ihm in seiner Eigenschaft als Konsument benötigtes Ding an verschiedenen Orten präsent oder ungleichzeitig vorhanden sind und deshalb nicht unmittelbar zum Austausch kommen können. Dabei muss das als Äquivalent fungierende Stellvertreterobjekt in dem doppelten Sinne allgemein sein, dass es von jedermann, der als Produzent oder Konsument zu Markte geht, als solches anerkannt ist und jedes marktgängige Ding, jedes Ding, das auf dem Markt erscheint und zirkuliert, vertreten kann. Nur wenn das als Äquivalent fungierende Stellvertreterobjekt diese subjektive und objektive Allgemeinheit besitzt, wenn es von allen und für alles als Passepartout akzeptiert wird, allen am Austausch Beteiligten als allen Tauschwerten, die in den Dingen verkörpert sind, gegebenenfalls gleichwertiger sichselbstgleicher Gegenwert gilt, kann der Austausch unter Bedingungen der Atopie beziehungsweise der Ungleichzeitigkeit, räumlicher und zeitlicher Asymmetrie, unter jenen als der Normalfall vorauszusetzenden Bedingungen also, die die Handeltreibenden und späteren Marktbetreiber überhaupt erst auf den Plan rufen, dennoch gelingen.
Das als Passepartout erscheinende Stellvertreterobjekt, das allgemeine Äquivalent, ist also von Anbeginn an ein konstitutiver Bestandteil der kommerziellen Funktion. Mit ihm als dem Konstitutiv ihrer Einschaltung in den Tauschverkehr der Produzenten machen die Handeltreibenden und späteren Marktbetreiber den Anfang – im klaren Unterschied zu den Produzenten selbst, die mit ihren auszutauschenden Produkten beginnen und nur durch die den Normalfall bildendene Asymmetrie der Austauschsituation gezwungen sind, die Handeltreibenden und das mit deren Aktivität untrennbar verknüpfte Ersatzobjekt allgemeines Äquivalent mit in den Kauf, besser gesagt, mit in den Tausch zu nehmen, der eben durch die den Austauschvorgang in zwei Akte aufspaltende Dazwischenkunft des allgemeinen Äquivalents erst zum Kauf wird, wie ja der als Synonym für den Handeltreibenden gebrauchte Begriff des Kaufmanns belegt.
Das allgemeine Äquivalent, mit dem die Handeltreibenden im Unterschied zu den Produzenten beim kommerziellen Austausch den Anfang machen, stellt die Bedingung der Möglichkeit ihrer Vermittlungstätigkeit dar und ist gleichzeitig Vehikel des uno actu der Vermittlungstätigkeit vonstatten gehenden Akkumulationsprozesses. Für ihre Vermittlertätigkeit geben die Handeltreibenden, wie bereits ausgeführt, den Produzenten für das von ihnen zu Markte getragene Produkt weniger allgemeines Äquivalent, weniger sichselbstgleichen Gegenwert, als dem in dem Produkt verkörperten Tauschwert entspricht, und realisieren dieses einbehaltene Stück Tauschwert als ein in ihren Händen verbleibendes Mehr an Wert, wenn sie das Produkt vermarkten, sprich, es den Produzenten in ihrer Rolle als Konsumenten im Austausch gegen allgemeines Äquivalent wiedergeben.
Dieser Mehrwert dient der von den Handeltreibenden beziehungsweise Marktbetreibern uno actu ihrer Vermittlertätigkeit, im unauflöslichen Verbund mit ihrer Vermarktungsaktivität betriebenen Akkumulation. Zwar scheint er zuerst und vor allem der Alimentation zu dienen und den Handeltreibenden, die als Nichtproduzenten ja auch leben müssen und mittels des beim Austauschvorgang in ihren Händen verbleibenden Mehr an allgemeinem Äquivalent sich selber als Konsumenten gegenübertreten können, die Möglichkeit zur Befriedigung ihrer subsistenziellen Bedürfnisse zu verschaffen. Aber so unbestreitbar diese Alimentationsfunktion, die der von dem Handeltreibenden in Form von allgemeinem Äquivalent erzielte Mehrwert erfüllt, empirisch auch sein mag, systematisch betrachtet, bleibt sie im Verhältnis zu dem Hauptzweck, dem der Mehrwert dient, dem Zweck der Akkumulation nämlich, ein sekundäres Motiv beziehungsweise eine bloße Begleiterscheinung.
Die im kommerziellen Akkumulationsprinzip beschlossene Selbstbezüglichkeit der Verwertungsperspektive lässt sich zwar von der materiellen Versorgungsperspektive, der der Handel dient, partout nicht trennen, weil erstere ja nur durch die Wahrnehmung der letzteren hindurch sich ins Werk zu setzen vermag. Aber zugleich verharrt erstere auch in absoluter Differenz zu letzterer, weil ihr ebenso illusionäres wie wahnhaftes Ein für alle Mal darauf gerichtet ist, sich aus ihrer Dienstbarkeit zu befreien und sich zu einem reinen Selbstvermittlungsverhältnis aufzuheben.
Durch die gesamte Geschichte kommerziellen Austauschs zuerst auf dem Wege bloßen Handels und dann auch im Rahmen des durch den akkumulativen Erfolg des Handels hervorgetriebenen Marktes hindurch ist die Aneignung von Mehrwert zu dem wesentlichen, wo nicht gar ausschließlichen Zwecke der Aneignung weiteren Mehrwerts, kurz, die Akkumulation, das wenn nicht grundlegende, so jedenfalls maßgebende Prinzip der kommerziellen Funktion – und dass der Akkumulationsprozess, dem sich die kommerzielle Funktion ab ovo verschreibt, nur vonstatten gehen und andauern kann, wenn die den Prozess Betreibenden selber ihren Lebensunterhalt finden und deshalb einen Teil des angeeigneten Mehrwerts für letzteren verwenden, ändert an jenem die kommerzielle Funktion beherrschenden Prinzip und an der imperativen Geltung, die es sich in jedem Handel und auf allen Märkten verschafft, nicht das Geringste.
Die systematischen Gründe beziehungsweise historischen Ursachen für dieses eigentümliche und mit dem für die kommerzielle Funktion konstitutiven allgemeinen Äquivalent untrennbar verknüpfte Prinzip der Akkumulation sollen hier nicht Thema sein. Sie finden sich an anderer Stelle ausführlich erörtert und dargelegt. 8 Wichtig im Rahmen unserer derzeitigen Überlegungen aber ist, dass wir uns klar machen, welche Konsequenzen beziehungsweise Implikationen dieses maßgebende Prinzip der kommerziellen Funktion für das Verhältnis der Handeltreibenden zu ihrer Tätigkeit, dem Austausch, hat. Es bedeutet nämlich, dass die Handeltreibenden nicht nur mit dem in der selbständigen, sichselbstgleichen Gestalt des allgemeinen Äquivalents erscheinenden Tauschwert des Produkts, statt mit dem Produkt selbst, den Anfang machen, sondern dass sie auch und mehr noch mit diesem als allgemeines Äquivalent gestaltgewordenen, statt bloß in Produkten verkörperten Tauschwert den Austauschvorgang beschließen – nur um stante pede oder jedenfalls so rasch wie möglich in einem neuen Austauschvorgang wieder mit ihm anzufangen.
Der Unterschied ihrer Intention und Praxis zur Intention und Praxis der Produzenten ist somit total und hat in der Tat die Form eines diametralen Gegensatzes. Während der Produzent den Austausch mit seinem Produkt beginnt, um ihn mit einem anderen Produkt zu beschließen, und sich nur wegen der im Normalfall asymmetrischen Austauschsituation gezwungen sieht, auf das uno actu als Austauschmittel und Akkumulationsinstrument dienende Stellvertreterobjekt allgemeines Äquivalent zu rekurrieren, beginnt umgekehrt der überhaupt erst durch die Notwendigkeit jenes allgemeinen Äquivalents zum Zuge kommende und den Austausch als kommerziellen Prozess installierende Handeltreibende diesen Austauschprozess mit seinem allgemeinen Äquivalent, um ihn mit einem nun nicht zwar anderen (wie sollte das angesichts der sichselbstgleichen Wertnatur des letzteren, seinem Maßstabcharakter, auch möglich sein!), wohl aber vermehrten allgemeinen Äquivalent zu beschließen.
Während es für den Produzenten ausschließlich um eine Verwandlung des für ihn das A und O des Austauschs bildenden Produkts geht, geht es für den Handeltreibenden ebenso ausschließlich um eine Vermehrung des allgemeinen Äquivalents, mit dem er den Austausch beginnt und beschließt. Für letzteren ist dabei das Produkt, in das sich das allgemeine Äquivalent verwandelt, um aus ihm vermehrt hervorzugehen, ebenso sehr ein bloßes Durchgangsmoment, ein in bezug auf den Akkumulationsprozess, auf den er aus ist, zwar der Funktion nach notwendiges, der Sache nach aber irrelevantes Element, wie für ersteren, dem es um seine materielle Versorgung zu tun ist, das allgemeine Äquivalent, in das er sein Produkt überführt, um mittels seiner ein anderes Produkt zu erwerben. Wie es also dem Produzenten ausschließlich um eine qualitative Veränderung, eine faktische Transformation von Dingen geht, die eine zwischenzeitliche Quantifizierung der Dinge, ihre Wahrnehmung als Wert, nötig macht, so geht es dem Handeltreibenden nicht minder ausschließlich um eine quantitative Vergrößerung, eine numerische Aggregation von Wert, die dessen vorübergehende Qualifizierung, seine Verkörperung in Produkten, erfordert.
So systematisch oder syntaktisch richtig diese strukturalisierende Darstellung aber auch sein mag, sie darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass, empirisch-historisch betrachtet, die beiden gegensätzlichen Positionen nicht die gleiche Seinsebene einnehmen, einander, was ihr existenzielles Verhältnis angeht, nicht gleichgeordnet sind. Der subsistenzielle Austausch, den die Produzenten praktizieren, hat ein anderes, unmittelbareres und eigenständigeres Sein als der kommerzielle Austausch, den die Handeltreibenden betreiben. Der erstere ergibt sich zwingend aus der mit dem gesellschaftlichen Dasein der Menschen untrennbar verknüpften arbeitsteiligen Form ihrer Reproduktion; er wäre auch existent, müsste auch stattfinden, wenn es den kommerziellen Austausch nicht gäbe. Dieser entsteht erst unter der faktischen Voraussetzung und auf der materialen Basis des subsistenziellen Austauschs – als an sich nur ein probates Mittel, dem letzteren aus seiner ihm durch die Asymmetrie des subsistenziellen Austauschverhältnisses, die der Normalfall ist, erwachsenden und ihn regelrecht zu vereiteln drohenden Not herauszuhelfen. Der kommerzielle Austausch springt dem subsistenziellen Austausch bei, fügt sich in ihn ein, interveniert in ihm, um ihn unter Bedingungen, unter denen er als solcher nicht funktionieren kann, dennoch funktionsfähig zu machen.
Aber so sehr der kommerzielle Austausch demnach formell oder nach der ihm vom subsistenziellen Austausch zugedachten Rolle ein dem letzteren ebenso sehr untergeordnetes wie eingegliedertes Hilfsmittel ist, so sehr ist dieses Mittel doch zugleich dank des ihm eingeschriebenen Akkumulationsprinzips und Verwertungsstrebens ein selbstbezügliches Medium, ein fürsichseiender Zweck. Mit dem Dienst einer Vermittlung qualitativ bestimmter Dinge, den er dem subsistenziellen Austausch erweist, führt der kommerzielle Austausch zugleich doch einen Selbstzweck, die quantitative Vergrößerung beziehungsweise Vermehrung nämlich des als Maßstab der Dinge die Vermittlung bewirkenden Mittels selbst im Schild.
Und dieses auf nichts als auf die quantitative Vermehrung zielende Fürsichsein oder Selbstzweckverhältnis des als Maßstab die qualitative Vermittlung bewirkenden Mittels, das als das allgemeine Äquivalent firmiert, ist dem kommerziellen Austausch beziehungsweise den ihn ausübenden Handeltreibenden in der Tat so wichtig, hat für letztere so ausschließliche Bedeutung oder imperativische Geltung, dass demgegenüber der qualitative Vermittlungsdienst, den das allgemeine Äquivalent leistet und um dessentwillen es durch Aneignung eines Teils des Werts des Vermittelten Selbstvermehrung betreiben darf, zu einem, prozessual gesehen, kursorischen Augenblick oder verschwindenden Moment beziehungsweise, intentional betrachtet, einer unvermeidlichen Nebenerscheinung, um nicht zu sagen, einem notwendigen Übel wird.
Genau in dieser Indifferenz und Negativität aber, mit der das dem allgemeinen Äquivalent eingeschriebene quantitative Selbstvermehrungsstreben dem qualitativen Vermittlungsdienst, den es leistet und durch den hindurch es sich realisiert, begegnet, liegt das Problem beziehungsweise tut sich ein Probleme schaffendes abgrundtiefes Paradox auf. Zwar unterscheidet sich die Indifferenz und Negativität, mit der der kommerzielle Austausch der Handeltreibenden dem subsistenziellen Austausch der Produzierenden begegnet beziehungsweise mit der er durch letzteren, fixiert auf seine eigene Zweckmäßigkeit, ebenso kursorisch wie nolens volens hindurchgeht, formell oder seiner logischen Struktur nach nicht von der Indifferenz und Negativität, mit der sich umgekehrt der subsistenzielle Austausch zum kommerziellen Austausch beziehungsweise zu dessen Mittel und Vehikel, dem allgemeinen Äquivalent, verhält, das ihm ebenso sehr als bloßes Durchgangsmoment, als im Doppelakt seiner Vermittlungstätigkeit sich erschöpfendes und aufhebendes Interludium gilt. Reell oder der empirischen Funktion nach indes ist da durchaus ein tiefgreifender Unterschied, jener erwähnte Unterschied nämlich der Seinsebene, jene existenzielle Differenz, die zwischen den beiden Austauschmodi besteht und die jeden strukturalistischen Versuch ihrer Gleichordnung Lügen straft.
Tatsache ist, dass der subsistenzielle Austausch das empirisch ebenso wie historisch Vorausgesetzte und Existierende, der kommerzielle Austausch hingegen ein erst unter der Voraussetzung des subsistenziellen Austauschs und gleichermaßen auf seinem Boden und in seinem Rahmen Einsetzendes und Intervenierendes ist. Tatsache ist, dass es primär und vor allem um die materiale Verteilung von subsistenziellen Befriedigungsmitteln geht und dass nur, weil die Verteilung einem sozialen Kriterium, dem der Gleichwertigkeit der in die Befriedigungsmittel gesteckten Arbeitsleistungen, genügen soll, das im Normalfall unmittelbar nicht gegeben ist und an dessen Nichterfüllung die Verteilung zu scheitern droht, der kommerzielle Austausch und sein Mittel, das durch seine Dazwischenkunft den Austausch nach Maßgabe jenes sozialen Kriteriums dennoch zustande bringende allgemeine Äquivalent, ins Spiel kommen. Tatsache ist, kurz gesagt, dass sich subsistenzieller und kommerzieller Austausch zueinander verhalten wie Substanz zur Funktion oder Zweck zum Mittel. Dass die Substanz die Funktion nur braucht, um sich ins Werk beziehungsweise in Szene zu setzen, dass der Zweck sich des Mittels nur bedient, um sich zu realisieren, und dass also die Substanz oder der Zweck die Funktion oder das Mittel nur als Durchgangsmoment gebrauchen, nur vorübergehend betätigen, um sich selbst in die Tat umzusetzen, ist in dem Sinne natürlich, dass in eben diesem selbstverleugnenden Engagement die Substanz der Funktion besteht, dass mit eben dieser effektiven Selbstaufhebung das Mittel seinen Zweck erfüllt.
Unnatürlich hingegen kann – und muss mehr noch! – erscheinen, dass nun beim kommerziellen Austausch dank des ihm eingeschriebenen Verwertungsdrangs oder Akkumulationsprinzips die Funktion sich um ihre eigene Achse dreht, das Mittel sich selbst zum Zweck wird; unnatürlich in dem Sinne, dass, und in dem Maße, wie nolens volens die um sich selbst kreisende Funktion die ursprüngliche Substanz als solche abdankt und im Eigeninteresse funktionalisiert, das zum Selbstzweck gewordene Mittel den eigentlichen Zweck, dem es dient, umgekehrt instrumentalisiert, zum bloßen Mittel degradiert. Und zwar nicht in dem Sinne funktionalisiert oder instrumentalisiert, dass nun die ursprüngliche Substanz oder der eigentliche Zweck, nämlich die qua subsistenzieller Austausch praktizierte materiale Verteilung von Befriedigungsmitteln, in den Dienst der Aneignung eines Teils des Verteilten durch die Betätiger der Funktion, die Handhaber des Mittels gestellt würde, dass also die im kommerziellen Austausch zur Geltung gebrachte Funktion, das von den Handeltreibenden eingesetzte Mittel, eben das allgemeine Äquivalent, von den letzteren genutzt würde, um materiale Verfügung über einen Teil des Verteilten zu erlangen! Wäre nur dies der Fall, wollten die Handeltreibenden sich mittels des eben dadurch als Zweck gesetzten Mittels nur in den Besitz von Verteiltem bringen, nur als Nutznießer an der materialen Verteilung teilhaben, man könnte sie vielleicht der Unredlichkeit, Arglist oder Habgier zeihen, sprich, ihr Tun moralisch anrüchig oder verwerflich finden, etwas Unnatürliches oder ein innerer Widerspruch ließe sich ihrem Vorgehen schwerlich vorwerfen!
Vielmehr resultiert das Unnatürliche oder der innere Widerspruch aus der erwähnten Tatsache, dass es im Prinzip der als Verwertungsdrang bestimmten Akkumulation bei der zum selbstbezüglichen Agens erhobenen Funktion, dem als Selbstzweck operierenden Mittel, keineswegs um materiale Verfügung über das Verteilte beziehungsweise einen Teil von ihm, sondern ausschließlich um soziale Verfügung über die Verteilung selbst, den als kommerzieller Austausch definierten Vermittlungsprozess als solchen, geht. Im Prinzip ihrer selbstbezüglich gewendeten kommerziellen Funktion, ihres sich selbst bezweckenden Austauschmittels streben die Marktbetreiber nicht nach materialer Befriedigung durch Beteiligung am Verteilten, sondern nach sozialer Macht durch Verfügung über die Verteilung.
Sie eignen sich einen Teil des für die materiale Verteilung, den Austausch von Subsistenzmitteln erforderlichen kommerziellen Mittels, des den Austausch vermittelnden allgemeinen Äquivalents an, nicht um mit dem angeeigneten Teil des Mittels selber am materialen Austausch teilzunehmen und persönliche Bedürfnisse zu befriedigen, sondern im Prinzip ausschließlich, um ihn für neue und weitere kommerzielle Austauschprozesse zu verwenden, um ihn mit anderen Worten als kommerzielles Austauschmittel in den materialen Austauschprozess der Produzenten oder Lieferanten des Marktes einzuspeisen und durch die solchermaßen vermehrte Menge an Austauschmittel sei's die bereits am Austausch teilnehmenden Produzenten zu vermehrter Güterproduktion und größeren materialen Beiträgen zu motivieren, sei's neue Produzenten für die Teilnahme am kommerziellen Austauschprozess, die Belieferung des Marktes mit materialen Beiträgen, zu gewinnen.
Die soziale Verfügung oder Macht, die statt materialer Versorgung oder Befriedigung von den Marktbetreibern mittels des allgemeinen Äquivalents, das sie als selbstbezügliche Funktion oder als sich selbst bezweckendes Mittel etablieren, angestrebt wird, zielt dabei nicht etwa auf ein ebenso willkürliches wie selbstherrliches Bestimmen und Entscheiden darüber, in welchem Maße die ihre Produkte zu Markte tragenden Produzenten am Austauschprozess beteiligt werden und wie viel sie davon im Sinne ihrer Bedürfnisbefriedigung, ihrer Versorgung mit Subsistenzmitteln profitieren, sondern erschöpft sich ausschließlich darin, den strikt in den geordneten Bahnen des Äquivalenzprinzips verlaufenden und von aller privativen Willkür und persönlichen Selbstherrlichkeit der Marktbetreiber denkbar weit entfernten Austauschprozess umfang- und inhaltsreicher werden, sprich, ihn durch eine Erweiterung des Kreises der teilnehmenden Produzenten sowie durch eine Steigerung der produktiven Beiträge der einzelnen Teilnehmer gleichermaßen an Totalität und Intensität gewinnen zu lassen.
Die soziale Gerechtigkeit des Austauschs, die nach Äquivalenz der Arbeitsleistungen oder produktiven Beiträge verlangt, wird durch das in der Selbstbezüglichkeit der Vermittlungsfunktion oder dem Selbstzweckcharakter des Austauschmittels zum Tragen kommende Streben der Marktbetreiber nach Verfügung und Macht keineswegs verletzt, sondern nur dahingehend modifiziert oder überdeterminiert, dass sie die ständige Erweiterung und Bereicherung des ihr dienenden Austauschsystems als conditio sine qua non seines Funktionierens mit einschließt. Das soziale Machtstreben, dem der kommerzielle Austausch durch das seinem wesentlichen Mittel, dem allgemeinen Äquivalent oder Geld, eingeschriebene Akkumulationsprinzip frönt, sprengt also eigentlich gar nicht den Rahmen des materialen Austauschsystems, auf dessen Boden und auf dessen Kosten es seine Befriedigung sucht und findet, sondern erschöpft sich letztlich in der Bekräftigung eben jenes materialen Austauschsystems – wobei Bekräftigung im doppelten Sinne von Entfaltung und Verstärkung, von quantitativem Auf- und qualitativem Ausbau zu verstehen ist.
Dieser Umstand, dass die soziale Macht über den materialen Austauschprozess, die das qua Akkumulation von allgemeinem Äquivalent sich selbst bezweckende Mittel den Marktbetreibern verschafft, ihren praktischen Ausdruck letztlich nur darin findet, dass sich der materiale Austauschprozess immer weiter totalisiert und intensiviert, sprich, dass immer mehr Produzenten in den zum Marktzusammenhang entfalteten Austauschprozess involviert und dazu gebracht werden, sich mit immer mehr Arbeitsleistung beziehungsweise Produktivkraft in ihm zu engagieren – dieser Umstand hat Karl Marx zu der Ansicht geführt, dass es sich bei dem ums allgemeine Äquivalent kreisenden Akkumulationsprozess, auf den die Marktbetreiber fixiert sind, gar nicht um einen echten selbstbezüglichen Funktionsmechanismus, ein wirkliches Selbstzweckverhältnis des kommerziellen Austauschmittels handele, sondern dass eben jene im Selbstbezug des Mittels implizierte, aus seinem Selbstzweckverhältnis konsequierende quantitative und qualitative Entfaltung der wirtschaftlichen Produktionssphäre und der gesellschaftlichen Produktivkräfte der wahre Sinn und letzte Zweck der vermeintlich bloß selbstbezüglichen kommerziellen Funktion, des scheinbar bloß sich selbst bezweckenden Austauschmittels sei.
Weil Marx aber gleichzeitig klarer als jeder andere sah, dass für die Betroffenen selbst, die Marktbetreiber, nichts anderes Geltung hat als der reine Selbstzweckcharakter des Mittels, nichts weiter existiert als das sich selbst vermehrende allgemeine Äquivalent, der sich selbst verwertende Wert, griff er zu dem Konstrukt einer als List der Vernunft deklarierten, hinter dem Rücken der Betroffenen oder in einer unbewussten Logik ihres bewussten Handelns sich vollziehenden Teleologie der Menschheitsentwicklung, kraft deren mittels des kommerziellen Austauschs und des ihn treibenden blinden Akkumulationsdrangs am Ende ein Niveau gesellschaftlicher Produktivität und darauf fußender umfassender Versorgung oder konsumtiver Fülle erreicht werde, das die Subsistenz als eine durch Mangel oder jedenfalls Knappheit der Bedürfnisbefriedigungsmittel gekennzeichnete und eben deshalb an das Prinzip von Leistung und Gegenleistung, das Wertverhältnis als ein Kriterium sozialer Gerechtigkeit gebundene Versorgungssituation transzendiere und hinfort eine vom Äquivalententausch und damit zugleich von dem kommerziellen Austausch, der im Zuge des Äquivalententauschs sich einschleicht und sein Akkumulationsprinzip zum Tragen bringt, befreite Güterverteilung möglich werden lasse.
Unter dem Eindruck der zu seiner Zeit in Gang kommenden und bis heute in rasantem Tempo fortschreitenden ungeheuren Produktivkraftentwicklung und in der Hoffnung auf die revolutionäre gesellschaftliche Bewegung, die diese Produktivkraftentwicklung als Reaktion auf die ökonomische Not und das soziale Elend auf Produzentenseite, von denen sie in ihrer anfänglichen Wildwüchsigkeit begleitet war, ins Leben rief, mochte Marx einem solchen geschichtsphilosophischen Optimismus, einer solchen quasieschatologischen Erwartung noch huldigen, dass am Ende der kapitalistischen Geschichte der bewusstlos von ihr verfolgte wahre Zweck einer vom Zwang des Austauschs und der Äquivalenz befreiten kommunistischen Überflussgesellschaft offenbar werde und dem vom Kommerz eingeführten und vom Kapital totalisierten Spuk einer ins schlecht Unendliche fortschreitenden Wertakkumulation ein Ende mache, sprich, das Mittel seines scheinbaren Selbstzweckcharakters beraube und als das bloße Mittel zum Zweck, das es sei, ad acta lege.
Mittlerweile freilich haben sich jene Hoffnungen auf eine kommunistische, vom industriekapitalistischen Akkumulationsprinzip und von dessen kommerzieller Grundlage, dem Äquivalententausch, befreite Überflussgesellschaft ebenso zerschlagen, wie die in solchen Hoffnungen grün- denden sozialrevolutionären Bewegungen verschwunden sind. Und gleichzeitig stellt sich die seit anderthalb Jahrhunderten fortschreitende gewaltige industrielle Produktivkraftentwicklung, deren materielle Segnungen die ökonomische Not und das soziale Elend, womit sie anfänglich einherging, allmählich beseitigt oder jedenfalls entschärft und damit den Grund für die Auflösung der sozialrevolutionären Bewegungen gelegt haben – gleichzeitig stellt sich diese Produktivkraftentwicklung, weit entfernt davon, den Keim einer in der Abschaffung der Marktgesellschaft bestehenden radikalen Neugestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens in sich zu tragen, als ein mit dem marktgesellschaftlichen Akkumulationsprinzip und Verwertungsdrang in dessen schlechte Unendlichkeit hinein nicht bloß konstitutionell vereinbarer, sondern mehr noch konditionell verknüpfter Prozess dar.
Mittlerweile scheint mit anderen Worten klar zu sein und auf der Hand zu liegen, dass jene generelle Produktionsentfaltung und spezifische Produktivkraftentwicklung, in der das soziale Machtstreben des das kommerzielle Austauschmittel zum Zweck des Austauschs erhebenden Akkumulationsprinzips seine Wirksamkeit erschöpft, ihrerseits ihren Sinn und Zweck darin erschöpfen, dem an die Akkumulation des Austauschmittels, die Selbstverwertung des Kapitals gebundenen sozialen Machtstreben immer weiter Befriedigung zu verschaffen und also den blinden Zirkel einer machtvollen Entfaltung des die Macht zu seiner Entfaltung verleihenden kapitalistischen Produktionsprozesses, den eben jenes als Akkumulationsprinzip perennierende Entfaltungsmotiv zur Spirale werden lässt, ad infinitum fortzusetzen.
Damit aber führt nun auch kein Weg mehr an der Wahrnehmung der oben konstatierten Paradoxie vorbei, die in der Indifferenz und Negativität beschlossen liegt, mit der das zum Selbstzweck erhobene kommerzielle Austauschmittel, das immer nur seine eigene akkumulative Verwertung betreibende allgemeine Äquivalent, das zuerst als Handelskapital und schließlich als selber ,,produktives" Kapital, als Kapital sans phrase, funktionierende Geld, dem als materialer Austausch bestimmten Zweckzusammenhang begegnet, dem es von Haus aus als Mittel dient und von dem es stets noch und unverbrüchlich als Mittel in Anspruch genommen wird. Und zwar besteht die Paradoxie, um nicht zu sagen, der als regelrechte contradictio in adjectum erscheinende innere Widerspruch darin, dass das Mittel des kommerziellen Austauschs, indem es sich selbst zum Zweck wird und hierbei seinen unmittelbaren Zweck, den subsistenziellen Austausch, vielmehr ins bloße Mittel dieser seiner selbstbezüglichen Zweckmäßigkeit verkehrt, einen Sprung in der Seinsebene, eine Art ontologischen Salto vollzieht, demzufolge es seine empirische Basis, seinen realen Boden, einer systematischen Perspektive, einem idealen Prospekt zum Opfer bringt oder, bildlicher gesprochen, seine irdisch-feste Grundlage ins Sprungbrett für einen ätherisch-fernen Höhenflug aufhebt.
Nicht dass das rein nur auf sich bezogene Mittel, indem es als Selbstzweck seinen unmittelbaren Zweck vielmehr zum Mittel verflüchtigt, sprich, zum Sprungbrett einer über ihn hinaus und aus ihm heraus führenden und sich als Selbstfindungsmotion beziehungsweise Selbstverwirklichungsaktion verstehenden permanenten Fluchtbewegung macht, aufhörte, in jenem unmittelbaren Zweckzusammenhang fundiert zu sein, nicht dass es ihm etwa gelänge, nicht mehr von dieser, durch den unmittelbaren Zweckzusammenhang definierten Welt zu sein! Aber fundiert in jenem Zweckzusammenhang ist es eben nurmehr ex negativo eines ständigen Sichablösens und Abhebens von ihm, und von dieser Welt ist es nurmehr in dem eskapistischen Sinne, dass es ständig von ihr weg will und sich von ihr freizumachen sucht. So gewiss aus Sicht der Marktbetreiber das Mittel sich zum monomanen Selbstzweck wird, so gewiss es in idealischer Zielstrebigkeit sich nurmehr um seine eigene Vermehrung und Vergrößerung dreht, so gewiss wird der unmittelbare Zweck, dem es dient, wird der die irdische Bedürfnisbefriedigung organisierende subsistenzielle Austausch, den es vermittelt, seinerseits zum bloßen Mittel dieser idealischen Zielstrebigkeit, zu einer Basis, die es, das als sein eigener Zweck zu sich kommende Mittel, ständig zu verlassen und zu vergessen, einer Voraussetzung, die es immer wieder zu transzendieren und nach getaner Schuldigkeit zu ignorieren strebt.
Natürlich bleibt das Abheben des Mittels, seine Ablösung von der als bloßes Sprungbrett seines Höhenflugs hinter ihm verschwindenden Basis, wie man will, illusorisch oder kursorisch, findet sich das Mittel also immer wieder flugs gezwungen, auf seine Basis haltsuchend zurückzufallen, sich seiner irdischen Voraussetzung immer wieder als der conditio sine qua non seines idealischen Höhenflugs zu versichern. Dass es aber dennoch unbeirrt an seinem die irdische Wirklichkeit des subsistenziellen Austauschs zum bloßen Mittel der idealischen Zweckmäßigkeit des kommerziellen Austauschs instrumentalisierenden, seinem auf das unendliche Ende, an dem es selbst das von seinem ursprünglichen Zweck befreiter sichselbstgleicher Zweck wäre, zielenden Streben festhält, beweist die Tatsache, dass aus seiner Sicht beziehungsweise aus Sicht der es als Selbstzweck betätigenden Marktbetreiber dieser Rückfall als von vornherein im Vorsatz eines neuerlichen Absprungs aufgehobenes reines Atemholen oder Kraftschöpfen erscheint, dergestalt, dass jedes Mal, wenn das idealisch selbstbezügliche Mittel wieder herabstürzt und zur Basis seines vorausgesetzt irdischen Zweckes zurückkehrt, es dies nur tut, um aus ihr die gemäß der jeweils größeren Entfernung, aus der es herabstürzt, vergrößerte Sprungkraft oder Bewegungsenergie für einen erneuten Absprung, einen weiteren, das Mittel dem infinitesimalen Fluchtpunkt seiner idealisch angestrebten Sichselbstgleichheit noch ein Stückchen näher bringenden ontologischen Salto zu gewinnen – womit, um im Bild zu bleiben, das Mittel einem Trampolinspringer gleicht, der die Bewegungsenergie seines gespannten Herabfallens nutzt, um die in der elastischen Grundlage seiner Sprünge steckende Spannkraft oder potentielle Energie zu mobilisieren und zu einem noch höheren Sprung, einer noch effektiveren Suspendierung der irdischen Schwerkraft zu nutzen.
Weit gefehlt also, dass diese Tatsache des ewigen Gebundenbleibens an seine in jenem ursprünglichen Zweck des subsistenziellen Austauschs bestehende irdische Grundlage das sich im kommerziellen Austausch als Selbstzweck verfolgende Mittel zur Vernunft eben jener ursprünglichen Zweckmäßigkeit zurückbrächte, spornt es letzteres in seinem selbstbezüglichen Elan nur an und findet sich von ihm aus einer Fessel in eine Feder, aus einer Hemmung in einen Impuls oder, wie gesagt, aus einer Grundlage in ein Sprungbrett umfunktioniert. Damit aber beweist denn auch das als Selbstzweck auf sich bezügliche Mittel des kommerziellen Austauschs, das seiner eigenen Vermehrung oder Akkumulation sich verschreibende allgemeine Äquivalent, der seiner Selbstverwertung sich weihende Wert jene oben vermerkte Paradoxie oder innere Widersprüchlichkeit, an einem von der irdischen Basis, auf der er fußt, unabhängigen, idealischen Punkt sich festzumachen oder besser gesagt aufzuhängen und von diesem zum absoluten Zweck der ganzen Veranstaltung erklärten Punkt her die irdische Basis zum ebenso verschwindenden wie kursorischen Durchgangsmoment einer ausschließlich auf das Erreichen des Punktes gerichteten Motion werden zu lassen.
Sinn der Vollendung der Motion, des Erreichens des idealischen Punktes, wäre die Überführung der Idealität in Realität, die Einlösung des Anspruchs des Mittels, sein eigener Zweck zu sein: Indem es ihm gelänge, den Punkt zu erreichen, an dem es sich in solchem Maße oder vielmehr Unmaß vermehrt, akkumuliert hätte, dass es jenes Durchgangsmoments seiner Akkumulation ein für alle Mal entraten, seinen unmittelbaren Zweck, seine irdische Basis fahren lassen und endgültig zum Verschwinden bringen könnte, wäre es sich selbst zur Basis geworden, hätte sich als sein eigener Grund etabliert, wäre wirklich und wahrhaftig sich selbst tragendes Mittel, sich selbst vermittelnder Zweck.
Aber so als ein auf sich fußendes Corpus, ein auf sich selbst bauendes Konstrukt gefasst, als ein Zweck begriffen, der sich in seinem Mittel beziehungsweise in dessen Totalisierung erschöpft, bleibt der idealische Punkt nolens volens eine Illusion. Sich als sein eigener, autonomer Zweck verfolgen kann das Mittel ja nur kraft der Dienstbarkeit, in der es zu jenem unmittelbar anderen, heteronomen Zweck des zur menschlichen Bedürfnisbefriedigung erforderlichen subsistenziellen Austauschs verharrt, sich als ausschließlich auf die eigene Entfaltung, auf Akkumulation, gerichteter Selbstbezug behaupten kann es sich ja nur, solange es gleichzeitig den Fremdbezug einer mittels seiner geleisteten Abwicklung der im Austausch materialer Güter bestehenden kommerziellen Transaktionen wahrt. Weil es seinem Autonomiestreben, seiner Bestrebung, ausschließlich für sich da zu sein, einzig und allein sich selbst zum Zweck zu haben, nur im wie sehr auch fortlaufend negierten Rahmen seiner heteronomen Zweckdienlichkeit, sprich, auf dem wie sehr auch immer wieder zum Verschwinden gebrachten Boden seiner kommerziellen, den Austausch materialer Güter besorgenden Vermittlungstätigkeit frönen kann, kommt es von jener heteronomen Basis nie und nimmer los.
Das Autonomiestreben oder der exklusive Selbstbezug des sich bezweckenden Mittels, des sich verwertenden Werts, ist von dessen heteronomer Zweckdienlichkeit, dem inklusiven Fremdbezug seiner kommerziellen Vermittlungsaufgabe ebenso wenig zu trennen, wie die Wertakkumulation in der abstrakten Form einer Vermehrung des markteigenen allgemeinen Äquivalents sich unabhängig von der Wertappropriation in der konkreten Gestalt der für den Austausch auf dem Markt produzierten materialen Güter denken lässt.
Oder besser gesagt, ist das eine, das Streben des Mittels nach einer Sichselbstgleichheit, in der es keinen anderen Zweck mehr als sich selbst und sich insofern zu einem reinen Selbstvermittlungsverhältnis aufgehoben hätte, eine idealische Projektion, die nur auf dem Boden und im Rahmen der empirischen Realität jener es als bloßes Mittel reklamierenden Zweckmäßigkeit des subsistenziellen Austauschs entsteht und gedeiht, weil sie im Grunde nichts anderes ist als die zum insgeheim herrschaftlichen Allmachtsbewusstsein verstiegene Anmaßung eines für die gesellschaftliche Subsistenz offenbar unentbehrlich gewordenen dienerschaftlichen Engagements, der selbstverleugnende Größenwahn des Handeltreibenden, der sich aus dem dienerschaftlichen Faktotum einer die Gesellschaft regierenden Herrschaft zum quasiherrschaftlichen Intendanten eines die Gesellschaft organisierenden Marktes mausert – eine idealische Projektion, die sich in dem Augenblick als schiere Illusion entlarvte, wo sie als solche Realität zu werden beanspruchte, sich als empirisches Faktum unter Beweis zu stellen suchte und sich von ihrem Nährboden, der empirischen Realität des subsistenziellen Austauschs endgültig ablöste, sich dieser ihrer heteronomen Basis ein für alle Mal überhöbe.
In dem Augenblick, wo es seine heteronome Vermittlungstätigkeit einstellte und nurmehr selbstbegründeter Zweck sein, sich auf ganz und gar eigene Füße stellen wollte, würde es seiner Bodenlosigkeit inne und stürzte als das zu Stein gewordene Brot oder als der in einen tödlichen Ballast verkehrte Schatz in den Abgrund seiner Verstiegenheit hinab, führe als der Leichnam seines lebendigen Mittlertums in die Grube seiner unmittelbaren Sinnlosigkeit, seines offenbaren Nichts.
Dies also ist die Paradoxie oder innere Widersprüchlichkeit, die dem von den Handeltreibenden beziehungsweise Marktbetreibern ihrem Passepartout, dem allgemeinen Äquivalent, das als kommerzielles Austauschmittel fungiert, qua Akkumulationsprinzip beigemessenen Selbstzweckcharakter von Anfang an eignet. Indem sich aus ihrer Perspektive das allgemeine Äquivalent nur immer auf sich selbst und seine eigene Vermehrung bezieht und indem sich hinter diesem für die Marktbetreiber absolut verbindlichen Selbstbezug des allgemeinen Äquivalents offenbar keinerlei heimliche andere Zweckmäßigkeit, keine wie immer geartete Marxsche List der Vernunft verbirgt, machen sie sich einer Projektion schuldig, die, als Projekt ernst genommen, sprich, auf das idealische Ziel einer Selbstbegründung, kraft deren das allgemeine Äquivalent gar nicht mehr Mittel zum heteronomen Zweck, sondern nur noch sich autonom vermittelnder Selbstzweck wäre, als auf ein empirisches Ende gerichtet, Illusion ist und als solche, als ein ihr ganzes Verhalten, ihr gesellschaftliches Tun und Lassen bestimmender Wahn, ihre Beziehung zur irdischen Wirklichkeit, verglichen mit dem Verhältnis, das die anderen, die für den Markt Produzierenden beziehungsweise mittels seiner Subsistierenden zu ihr unterhalten, gründlich alteriert und zwischen der eigenen Wahrnehmung jener Wirklichkeit, die in Wahrheit ja eher ein Absehen und Abstrahieren von ihr, ein ständiges Negieren und Verflüchtigen ist, und der Vorstellung, die die anderen von ihr haben, der Affirmation und Zuwendung, mit der sie ihr begegnen, eine geradezu ontologische Differenz begründet, sprich, eine eigentlich unüberbrückbare Kluft aufreißt.
Solange die Verwertungsperspektive nur kommerzieller Natur ist, bleibt sie durch die Versorgungsperspektive kaschiert und kann von allen Beteiligten ignoriert werden. Zu Beginn der Neuzeit aber gewinnt sie manufakturell-industrielles Gepräge, weil das Handelskapital anfängt, sich der Produktionssphäre zu bemächtigen, und damit nicht mehr erst in der materialen Vermitteltheit fertiger Produkte, sondern bereits in der kapitalen Unmittelbarkeit von Lohnarbeit und Produktionsfaktoren erscheint.
Eigentlich unüberbrückbar ist die Kluft, aber nicht in Wirklichkeit! Was hindert, dass die Kluft zwischen den Perspektiven der am subsistenziellen Austausch interessierten Produzenten und der den subsistenziellen Austausch als kommerziellen organisierenden Marktbetreiber sichtbar wird und als ein eigentlich oder an sich ebenso sehr die gesellschaftliche Einheit und Kontinuität zerreißendes wie das Verhältnis zur Welt und Bewusstsein ihrer Realität untergrabendes und sprengendes Schisma Geltung gewinnt, und was macht, dass der Wahn der Marktbetreiber, der die von den Produzenten bearbeitete irdische Welt ständig in den idealischen Fluchtpunkt der als akkumulative Wertbildung vor sich gehenden Selbstvermittlung des die Verteilung der Arbeitsprodukte besorgenden kommerziellen Mittels treibt und darin zum Verschwinden bringt – was also macht, dass dieser Wahn quasi unbemerkt bleibt und als in petto des subsistenziellen Austauschs, der nur als kommerzieller funktioniert, ebenso stillschweigend wie unabdingbar mitlaufender keinen Schaden anrichtet, ist eben die bemerkte Tatsache, dass seine Befriedigung, die Verfolgung der in Akkumulation bestehenden Selbstvermittlung des Austauschmittels, seiner auf die eigene Zunahme und Vermehrung fokussierten autonomen Zweckmäßigkeit, kurz, seiner Etablierung als reiner Selbstzweck, immer noch unfehlbar geknüpft bleibt an die Erfüllung jener anderen, heteronomen Zweckmäßigkeit, kraft deren er als Mittel zum Zwecke subsistenzieller Austauschprozesse dient. Nur wenn und insofern das aus Sicht der Marktbetreiber rein selbstbezügliche Mittel, das allgemeine Äquivalent, jedes Mal wieder investiert, in materiale Güter umgesetzt oder inkorporiert wird und jedes Mal wieder diese materialen Güter subsistenziell ausgetauscht, das heißt, als Subsistenzmittel oder Konsumgüter an den Mann oder die Frau gebracht werden, funktioniert die als Akkumulation erscheinende Selbstverwertung des Werts, die vom allgemeinen Äquivalent in all seiner Vermittlungstätigkeit wesentlich nur angestrebte und auf Selbstvermehrung abgestellte Selbstvermittlung.
Weil und solange der von den Marktbetreibern hochgehaltene kommerzielle Selbstzweckcharakter des allgemeinen Äquivalents, seine akkumulative Selbstvermittlung stets nur per medium der Distribution materialer Produkte, modo obliquo also des Kaufens und Wiederverkaufens von Subsistenzmitteln und Konsumgütern zur Geltung kommen kann, haben die Produzenten in specie und hat die Gesellschaft in genere keinen Grund, jenen Selbstzweckcharakter zur Kenntnis zu nehmen, und können sie sich unter Ausblendung des letzteren voll und ganz darauf beschränken, das allgemeine Äquivalent in der Rolle des zum Zwecke des subsistenziellen Austauschs, der Distribution materialer Güter dienlichen kommerziellen Mittels zu gewahren und zu goutieren.
Sie haben umso weniger Grund, die Selbstvermittlung des allgemeinen Äquivalents als mit seiner heteronomen Zweckbestimmung konfligierend wahrzunehmen, und können umso leichter den konstitutionell-wahnhaften Akkumulationstrieb des Austauschmittels hinter seiner reali- tätstüchtig-subsistenziellen Distributionsfunktion verschwinden lassen und aus dem Auge verlieren, als ja der dem allgemeinen Äquivalent eingeschriebene wahnhafte Akkumulationstrieb der subsistenziellen Distributionsfunktion, die im traditionellen Austauschzusammenhang das allgemeine Äquivalent erfüllt, nicht nur nicht in die Quere kommt und keinen Abbruch tut, sondern mehr noch zugute kommt und Vorschub leistet, insofern er, wie bereit angemerkt, eine ständige Expansion des Marktes und eine entsprechende quantitative Vermehrung und qualitative Vervielfältigung der für den subsistenziellen Austausch produzierten Subsistenzmittel und Konsumgüter bewirkt und also jene Entfaltung der gesellschaftlichen Produktivkräfte und der korrespondierenden menschlichen Bedürfnisbefriedigung zur Folge hat, die Marx fälschlich dazu bewog, in ihm eine von der Gattungsgeschichte zielstrebig angewandte und die habituelle Trägheit und rituelle Widerständigkeit der empirischen Individuen und Sozialverbände zu überwinden bestimmte List der Vernunft zu gewahren. Und diese Möglichkeit, die wahnhafte Perspektive, die der dem allgemeinen Äquivalent eingeschriebene Selbstverwertungsdrang ihnen zum kategorischen Imperativ all ihrer Handelstätigkeit macht, hinter dem subsistenziellen Austausch, den sie betreiben, und den materialen Gütern, die sie zirkulieren lassen, zum Verschwinden zu bringen und als eine selbstredende beziehungsweise stillschweigende Implikation ihres Tuns gar nicht eigens zur Kenntnis zu nehmen, haben auch und ebenso sehr die Marktbetreiber selbst. Von der ihnen aufgetragenen kommerziellen Abwicklung des subsistenziellen Austauschs primär in Anspruch genommen, können sie das dem kommerziellen Austauschmittel als Selbstverwertungsdrang eigene Selbstzweckmoment als ein natürliches Konstitutiv allen Austauschs ebenso sehr ignorieren wie gelten lassen und können so ihrem in jenem Selbstzweckmoment des Austauschmittels beschlossenen Wahn mit dem guten Gewissen der gesellschaftlichen Nützlichkeit und Fortschrittlichkeit, die er im traditionellen Kontext beweist, im Bewusstsein also der Entfaltung des Marktes, die er ermöglicht, und der Entwicklung der Produktivkräfte, die er bewirkt, ungestört frönen.
Genau diese ebenso tolerante wie ignorante beziehungsweise ebenso affirmative wie indifferente Haltung indes, mit der die Produzenten und Konsumenten dem als Akkumulationsprinzip wirksamen wahnhaften Selbstvermittlungsdrang des kommerziellen Mittels begegnen beziehungsweise die Marktbetreiber ihm frönen – genau diese Haltung droht zu Anfang der Neuzeit ins Wanken zu geraten oder gar unhaltbar zu werden, weil das, was sie bis dahin fundiert und stützt, die Verschleierung und Tarnung des idealischen Selbstzweckcharakters des kommerziellen Mittels oder allgemeinen Äquivalents durch dessen ständig wiederkehrende Verkörperung in irdischen Dingen, seine Verwandlung in materiale Güter, kurz, sein ständiges Verschwinden im subsistenziellen Austausch, aufzufliegen und wegzufallen beginnt. Dass der empirische Schleier, der den idealischen Wahn kaschiert, zerreißt, dass die Tarnung des im Akkumulationsprinzip wirksamen Irrsinns autonomer Selbstvermittlung durch den Anschein fortlaufender heteronomer Zweckmäßigkeit auffliegt, ist dabei einer ganz und gar internen kommerziellen Dynamik geschuldet, die zum Ende des so genannten Mittelalters unverhoffte Früchte trägt und den Markt in einer nie dagewesenen Weise über sich selbst hinaustreibt.
Ihren Grund hat diese Dynamik in der anders gearteten Konstitution, die im Vergleich mit der Beschaffenheit des antiken Marktes der nach dem Zusammenbruch des römischen Imperiums wiedererstehende Markt von Anbeginn aufweist. Anders als der antike ist der postimperiale Markt keiner, der erst im Nachhinein an der Peripherie längst existierender territorialherrschaftlicher Gesellschaften entsteht, in eigenen, von einem quasiterritorialherrschaftlichen, aristokratischen Element getragenen, politisch unabhängigen, stadtstaatlichen Gemeinschaften gründet und mit den umgebenden Territorialherrschaften einen durch deren relative Autarkie ebenso sehr begrenzten wie durch ein gewisses Maß an Arbeitsteilung zwischen städtisch-handwerklicher Güterproduktion und landwirtschaftlich-territorialer Lebensmittelerzeugung ermöglichten und kontinuierlich gemachten kommerziellen Austausch pflegt. Vielmehr reicht der postimperiale Markt mit seinen Anfängen ebenso weit zurück wie die auf den Trümmern des Römischen Reichs als feudale neu erstehenden territorialherrschaftlichen Gesellschaften, fasst nicht an der Peripherie, sondern inmitten der letzteren Fuß und etabliert sich als der Kern- und Angelpunkt einer allen territorialherrschaftlichen Elements baren, vornehmlich handwerklich tätigen Stadtgemeinde, die er mit ihresgleichen, mit den überall in den territorialen Gesellschaften verstreuten Marktstädten, durch Austauschbeziehungen verbindet und zu einem die herrschaftlichen Territorien, einem Myzel vergleichbar, durchziehenden Handelssystem verknüpft. Der kommerzielle Austausch, das Marktgeschehen auf Geldbasis und also in einem akkumulationsrelevanten Sinn, beschränkt sich dabei weitgehend auf die Handelsbeziehungen zwischen den Stadtgemeinschaften, ihren Verkehr untereinander; mit der fronwirtschaftlich-territorialen Gesellschaft, in die sie eingebettet sind, treiben die Stadtgemeinschaften im Rahmen lokaler Märkte Tauschhandel, der sie mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und ihre ländliche Umgebung mit handwerklichen Produkten versorgt, ohne aber für die kommerzielle Reichtumsbildung, den handelskapitalen Akkumulationsprozess, von nennenswerter Relevanz zu sein.
In einem Punkte allerdings gewinnen die territorialherrschaftlichen Gesellschaften für das Marktsystem der handwerklichen Stadtgemeinschaften und dessen Wachstum und Gedeihen eine maßgebliche Bedeutung, im Punkte nämlich der Konsumentenrolle, die die Oberschichten dieser Gesellschaften, die territorialen Herrschaften selbst, im Rahmen des Marktsystems übernehmen. Dank des ihnen als traditionell-thesaurisches Herrengut zur Verfügung stehenden und von ihnen als allgemeines Äquivalent, als Münze des Marktes, einsetzbaren Edelmetalls können die feudalen Herrschaften eine ökonomische Funktion erfüllen, mit deren Wahrnehmung jeder kommerzielle Austauschzusammenhang im Allgemeinen und jedes Marktsystem im Besonderen steht und fällt: die Funktion nämlich einer geldlichen Einlösung oder wertförmigen Realisierung des von den Produzenten geschaffenen und den Händlern beziehungsweise Marktbetreibern als ihr Anteil und Gewinn zufallenden Mehrwerts. Weil in jedem kommerziellen, durch ein allgemeines Äquivalent vermittelten Austauschzusammenhang dieser Mehrwert, um den sich der aller kommerziellen Funktion qua Akkumulation eingeschriebene Grundtrieb dreht, dem Produktionsprozess in Gestalt materialer Produkte entspringt und per definitionem der Mehrwertigkeit der Produkte von den Produzenten selbst mit dem ihnen für die Produkte überlassenen allgemeinen Äquivalent nicht geldlich eingelöst, sprich, in seiner Wertform realisiert werden kann, braucht es eine dritte Gruppe, die über Edelmetall aus marktunabhängigen Quellen verfügt und dieses Edelmetall in ihren Händen als allgemeines Äquivalent nutzt, um nicht in produzierender Eigenschaft, sondern ausschließlich in der Rolle von Konsumenten am Markt teilzuhaben und für die Realisierung des von den Produzenten in Gütergestalt geschaffenen Mehrwerts zu sorgen.
Durch diese Rolle der Mehrwertrealisierer vom Dienst, die sie als reine Konsumenten übernehmen, sind die herrschenden Schichten der territorialherschaftlichen Gesellschaften nachimperialen Gepräges, sprich, feudalen Zuschnitts, dem stadtgemeinschaftlichen Marktsystem, das ihre Territorien durchzieht, ebenso sehr ökonomisch-funktionell integriert wie politisch-sozial verbunden. Das handwerklich-städtische Marktsystem braucht jene herrschaftlich-territorialen Schichten, um dem ihm eingeschriebenen Imperativ des Akkumulationsprinzips, der unabdingbaren Forderung nach Wertbildung sans phrase, nach in der Wertform realisiertem Mehrwert, genügen zu können – und eben deshalb richtet sich das Marktsystem, unbeschadet seiner handwerklichen Basis und stadtgemeinschaftlichen Konstitution, von Anfang an auch und wesentlich auf die Befriedigung der Bedürfnisse und konsumtiven Ansprüche jener territorialen Herrschaften. Und zur Befriedigung dieser ihrer konsumtiven Bedürfnisse und Verwirklichung beziehungsweise Erhaltung des Lebensstandards, den ihr als allgemeines Äquivalent nutzbares thesaurisches Herrengut, ihr Edelmetall aus marktunabhängigen Quellen, ihnen ermöglicht, brauchen die herrschaftlichen Schichten umgekehrt das Marktsystem mit den in ihm organisierten handwerklichen Stadtgemeinschaften, weshalb sie den letzteren einen relativen Freiraum und weitgehende Selbstverwaltung gewähren und dem ersteren relative Freizügigkeit einräumen und Schutz und Förderung angedeihen lassen.
Die funktionelle Arbeitsteilung beziehungsweise soziale Kooperation zwischen erstens den um ihrer marktvermittelten Subsistenz willen für den Markt arbeitenden und ein Mehrprodukt erzeugenden städtisch-handwerklichen Produzenten, zweitens den Organisatoren und Betreibern des die Stadtgemeinschaften umfassenden Marktsystems und drittens den das Mehrprodukt als Mehrwert realisierenden territorialherrschaftlichen Konsumenten ist auf diese Weise perfekt und lässt, abgesehen von äußeren, durch Kriege, Seuchen, Hungersnöte oder Verbrechen verursachten Störungen, keinen Raum für strukturelle Verwerfungen und dauerhafte Beeinträchtigungen: Keine der drei teilnehmenden Parteien kommt der anderen ins Gehege beziehungsweise in die Quere, und alle wirken sie auf der Basis einer ungestörten Verfolgung ihres eigenen Interesses am Auf- und Ausbau des Marktsystems, sprich, an einem handelskapitalen Akkumulationsprozess mit, der quantitativ immer weitere Produzenten- und Konsumentenkreise und qualitativ immer zahlreichere und vielfältigere Befriedigungsmittel in den Marktzusammenhang einbezieht und integriert.
In puncto dieser perfekten Arbeitsteilung oder, besser gesagt, Aufteilung der Kompetenzen ist das nachimperial-mittelalterliche Marktsystem dem vorimperial-antiken eindeutig überlegen, weil – wie andernorts dargestellt 9 – in der Antike die den Markt beherbergende Handelsstadt ebenso sehr ein soziales Amphibium, wie die in Fronwirtschaft gründende Territorialherrschaft ein funktionelles Zwittergebilde ist und nämlich die erstere ebenso sehr eine territorialherrschaftliche Komponente aufweist und neben dem handwerklichen einen gewichtigen bäuerlichen Beitrag zum Marktsystem leistet, wie die letztere sich keineswegs mit der Rolle der bloßen Konsumentin bescheidet, sondern nicht minder auch als Produzentin am Marktsystem teilhat und weil diese amphibolisch-zwittrige Konstitution der beiden am Marktsystem beteiligten Sozialformationen in der einen, der handelsstädtischen Gesellschaft, zu ökonomischen Verwerfungen und Diskrepanzen führt, die wiederum soziale Spannungen und politische Konflikte zur Folge haben, die die Handelsstadt schließlich dazu bringen, den Tugendpfad einer gesellschaftlichen Reproduktion auf der Grundlage kommerziell vermittelter vornehmlich handwerklicher und in geringerem Maße auch bäuerlicher Arbeit zu verlassen und sich auf eine Subsistenzsicherung beziehungsweise Bereicherung auf nichtkommerziellem Wege, nämlich mittels Ausbeutung der Bundesgenossen beziehungsweise Nachbarn durch militärische Requisitionen beziehungsweise bürokratische Konfiskationen, zu verlegen.
Zwar erreicht zwischenzeitlich auch die antike Handelsstadt eine der mittelalterlichen Funktionsteilung halbwegs vergleichbare Konstellation, indem sie, um der kommerziellen Stagnation zu entrinnen, die das Verhältnis zwischen amphibolischer Handelsstadt und zwittriger Territorialherrschaft bedroht, durch Ausdehnung ihres Handelssystems Gruppen von außerhalb der territorialherrschaftlichen Sphäre rekrutiert, die dank ihres Mangels an marktgängigen Produkten und ihrer Verfügung über als allgemeines Äquivalent nutzbares Edelmetall in der Rolle von reinen Konsumenten am Marktsystem teilzunehmen vermögen, aber so sehr diese neu gewonnenen Konsumentengruppen die Stagnation im Marktsystem beheben und ihm zu weiterem Wachstum und Gedeihen verhelfen, vor der Fatalität, die in der amphibolischen Konstitution der zugleich herrschaftlich-territorialen und handwerklich-kommunalen Konstitution der Handelsstadt und der zwittrigen Beschaffenheit der ebenso sehr als Produzenten wie als Konsumenten auf dem Markt erscheinenden territorialherrschaftlich-fronwirtschaftlichen Gesellschaften beschlossen liegt und die der kommerzielle Austausch zwischen Handelsstadt und Territorialherrschaft virulent werden lässt, und vor dem schließlichen Untergang, in den diese die Handelsstadt aus einem kommerziellen Profiteur in einen imperialen Ausbeuter verwandelnde Fatalität das antike Handelssystem treibt beziehungsweise mit hinabreißt, können sie letzteres nicht bewahren.
Von solcher Fatalität bleibt die kommerzielle Entwicklung der nach- imperial-mittelalterlichen Ära vollständig verschont. Dank der sich dort praktisch von Anfang an herstellenden strengen Funktionsteilung zwischen handwerklich-kommunalen Produzenten, handelsstädtischen Marktbetreibern und herrschaftlich-territorialen Konsumenten, bei der keine der beteiligten Gruppen der anderen ins Gehege kommt und alle drei den jeweils anderen hinlänglich von politischem beziehungsweise ökonomischem Nutzen sind, um von ihnen nicht nur toleriert, sondern mehr noch akzeptiert und gar gefördert zu werden, kann sich das Marktsystem dieser vielhundertjährigen Ära kontinuierlich und – abgesehen von den für menschliche Gesellschaften generell und vielleicht für die feudale Gesellschaft insonderheit typischen Konflikten, die politischer Ehrgeiz, ökonomische Habgier und militärische Schlagkraft heraufbeschwören – ungestört entfalten. Und zwar kann es sich derart kontinuierlich und ungestört entfalten, dass die gesellschaftliche Macht und politisch-ökonomische Bedeutung, die es auf diesem Wege erlangt, ausreicht, das Kontinuum jener vielhundertjährigen Ära, in der es sich ausgebildet hat, zu sprengen und ein in jeder Hinsicht, in Ansehung der politischen Konstitution und der sozialen Organisation nicht weniger als im Blick auf die ökonomische Struktur, neues Zeitalter zu begründen.
Motiviert und instigiert durch jene Macht und Bedeutung, die das Marktsystem in genere seines die europäischen Territorialherrschaften umspannenden beziehungsweise durchziehenden kommerziellen Netzwerks und in specie der als wirtschaftliche Knotenpunkte das Netzwerk gleichermaßen tragenden und speisenden handwerklich-städtischen Ballungszentren gewinnt, entwickeln die Territorialherren, die über jene Ballungszentren die politische Kontrolle ausüben und von dem aus ihnen sich speisenden Marktsystem am meisten ökonomisch profitieren, einen mit der überkommenen feudalen Herrschaftsordnung unvereinbaren Ehrgeiz und beginnen, indem sie ihresgleichen, ihre feudalen Standesgenossen und Konkurrenten, durch militärische Vertreibung, politische Entmachtung und finanzielle Abfindung ausschalten, einen Konzentrationsprozess, der das föderalistisch angelegte, ständisch-feudale Herrschaftssystem zertrümmert und aus der Konkursmasse eine Reihe von absolutistisch geordneten, bürokratisch-zentralen Territorialstaaten hervorgehen lässt.
Unterstützung und Förderung bei ihrem Streben nach absolutistischer Souveränität erhalten die sich der traditionell-feudalen Bindungen und Verpflichtungen entschlagenden Herren dieser Territorialstaaten neuen, zentralistischen Gepräges durch die Vertreter des Marktsystems, die Betreiber des Marktes, die Kaufmannschaft, die sich von dem neuen, die alten feudalen Strukturen zertrümmernden Herrscher die Erschließung neuer kommerzieller Entfaltungsräume und Investitionschancen und damit die Überwindung der Stagnation erhofft, in die am Ende des Mittelalters der Markt hineintreibt, weil seinem Wachstum die durch kommunale Verfassungen und territoriale Privilegien, durch das Korsett der feudalen Ordnung, eingeschränkten verfügbaren gesellschaftlichen Produktionskapazitäten nicht mehr zu genügen vermögen und der Mangel an handelskapitalen Investitionsmöglichkeiten den kommerziellen Verwertungsprozess zu lähmen und zum Erliegen zu bringen droht.
Die Rechnung der Marktbetreiber geht in der Tat auf: Für ihre finanzielle, politische und strategische Unterstützung finden sie sich von dem nach territorialer Souveränität strebenden Fürsten, dessen ganze Karriere im Grunde ja auf den ökonomischen Machtzentren aufbaut, die das von ihnen betriebene Marktsystem entstehen lässt, reichlich durch die Abtretung von Nutzungsrechten und die Gewährung von Handelsmonopolen entschädigt und vor allem aber dadurch belohnt, dass der Fürst seine neu gewonnene politische Macht zur Beseitigung und Aufhebung jener kommunalen Freiheiten und territorialen Privilegien nutzt, die nachgerade das Haupthindernis für die kommerzielle Expansions- und Investitionstätigkeit bilden.
Dabei geht die der fürstlichen Hilfestellung und Förderung geschuldete rasche Entfaltung des Marktsystems, die rasante Erschließung neuer Produktionskapazitäten und handelskapitaler Investitionsbereiche dank der glücklichen Fügung der gleichzeitig in Schwung kommenden kolonialen Expansion der unter absolutistischen Souveränen sich etablierenden zentralistischen Territorialstaaten einher mit einem Zufluss großer Mengen von in den Kolonien erbeutetem und als Münze des Marktes, als allgemeines Äquivalent nutzbarem Edelmetall, das, vom Souverän als Köder und Stillhalteprämie an seine Standesgenossen, die von ihm entmachtete und zum höfischen Gefolge degradierte adlige Oberschicht verteilt, deren Kaufkraft massiv erhöht, sprich, die Oberschicht in ihrer überkommenen Konsumentenrolle, der traditionell von ihr wahrgenommenen Funktion einer Realisiererin kommerziellen Mehrwerts ebenso umfänglich stärkt wie nachdrücklich reaffirmiert.
Dieses Zugleich aber von neuen Investitionschancen und verstärkter Konsumkraft hat einen ebenso beispiellosen wie rasanten Bereicherungsprozess auf Seiten der Marktbetreiber zur Folge, jenen Bereicherungsprozess, den später Karl Marx als ursprüngliche Akkumulation identifizieren wird, weil er in ihm den Ursprung oder die Grundlage einer ganz neuen Art von Akkumulation erkennt, die nicht mehr kommerzieller, sondern industrieller Natur ist, nicht mehr durch die Vermarktung von außerhalb des Marktes und nicht zwar funktionell, wohl aber institutionell unabhängig von ihm erzeugten Produkten, sondern durch die Verwertung des institutionell nicht weniger als funktionell vom Markt abhängigen beziehungsweise in ihn integrierten Produktionsprozesses selbst vonstatten geht. Weil die Marktbetreiber in der traditionellen Produktionssphäre für ihr akkumuliertes Handelskapital nicht mehr genug Investitionsmöglichkeiten vorfinden, nicht mehr genug Produkte antreffen, die sie vermarkten, zirkulativ vertreiben können, verlegen sie sich darauf, ihr überschüssiges Handelskapital in die Produktionssphäre als solche beziehungsweise ihr sächliches Inventar, die in ihr versammelten Produktionsmittel, zu investieren, um auf diesem Wege Einfluss auf den Produktionsprozess zu nehmen und ihn so umzugestalten und zu beschleunigen, dass er den dank rasanter Akkumulation gestiegenen Investitionsbedürfnissen des Marktes genügt.
Die Folge ist eine Integration der Produktionssphäre in den Markt und die Verlagerung des Akts der Aneignung von Mehrwert von der Ebene des fertigen Produkts auf die der zur Fertigung des Produkts erforderlichen Bedingungen und Faktoren. In dem Maße, wie die Marktbetreiber diese Bedingungen und Faktoren in ihren Besitz und unter ihre Verfügung bringen, trennen sie die Arbeitenden, die handgreiflichen Produzenten, von ihnen und zwingen die um ihrer Subsistenz willen auf sie Angewiesenen in ein Arbeitsverhältnis, das wesentlich unter ihrer, der Marktbetreiber, Regie steht und ihren Direktiven und Konditionen unterliegt. Den Mehrwert, den sie sich aneignen, gewinnen sie nicht mehr durch den im Verhältnis zum Wert des Produkts verminderten Preis, den sie den Produzenten für das von ihnen zu Markte getragene letztere zahlen, sondern durch den im Vergleich mit dem Wert des Produkts geringeren Lohn, den sie den Produzenten für ihre unter ihrer, der Marktbetreiber, Regie verrichtete produktive Tätigkeit geben.
Die Differenz zwischen dem Wert des Produkts und dem wertförmigen Entgelt, das der Produzent dafür erhält, eben der Mehrwert, kommt nicht mehr wie vorher dadurch zustande, dass der Produzent den Marktbetreibern für deren zirkulative Bemühungen einen zwar je nach ökonomischen Umständen variierenden, aber doch im empirischen Prinzip als Teil des Produktwerts firmierenden Wertanteil überlässt. Vielmehr resultiert die Differenz jetzt daraus, dass die Marktbetreiber den von seinen Arbeitsmitteln, den sächlichen Produktionsfaktoren, getrennten Produzenten als Arbeitskraft wertmäßig veranschlagen, ihm seinen Wert in Form von Lohn vergüten und dafür von ihm das gesamte, unter der Regie des Lohngebers erzeugte Produkt beziehungsweise den darin verkörperten Wert überlassen bekommen. Anders als beim Kauf der vom Produzenten in eigener Regie gefertigten Produkte durch die Marktbetreiber, wo der Wertanteil, den letztere für ihre zirkulative Leistung reklamieren, noch in einem rationalen, wenngleich Variationen unterworfenen Verhältnis zum Produktwert steht, weist der Lohn, den jetzt die Marktbetreiber dem Produzenten dafür zahlen, dass er ihnen zur Betätigung der in ihrem Besitz befindlichen Produktionsmittel seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, keine solche rationale Relation zum Wert des dieser Betätigung der Arbeitskraft entspringenden Produkts mehr auf, weil, systematisch betrachtet, sich im Lohnverhältnis der Produzent beziehungsweise seine Arbeitskraft der Kategorie der Produktionsmittel zugeschlagen, als quasi persönlicher Produktionsfaktor den übrigen, sächlichen Produktionsfaktoren gleichgestellt und nämlich, was seinen Wert beziehungsweise den seiner Arbeitskraft betrifft, wie letztere behandelt findet.
Der Wert der sächlichen Produktionsfaktoren bemisst sich an den Kosten ihrer Herstellung und Erhaltung. Und das Gleiche gilt nun auch für den als persönlicher Produktionsfaktor wohlverstandenen Produzenten beziehungsweise die Arbeitskraft, die er als Lohnarbeiter zu Markte trägt. Der Wert des Lohnarbeiters bemisst sich an den Kosten seiner individuellen und generischen Reproduktion und Regeneration, an den Subsistenzmitteln mit anderen Worten, die er und seine Familie brauchen, um sich ihre Arbeitskraft zu erhalten und physisch, seelisch, mental und sozial funktionsfähig zu bleiben.
Ein notwendiger Zusammenhang zwischen dem als Lohn erscheinenden Wert der Arbeitskraft und dem als Mehrwert von den Marktbetreibern reklamierten Wertanteil, wie ihn unter traditionellen ökonomischen Bedingungen die Tatsache garantiert, dass die Vergütung des Produzenten und der vom Marktbetreiber in Anspruch genommene Mehrwert beide als Teile des im fertigen Produkt verkörperten Werts präsent und hier und jetzt aufeinander bezogen beziehungsweise miteinander vergleichbar sind – ein solcher notwendiger Zusammenhang existiert im Rahmen des Lohnarbeitsverhältnisses nicht mehr. Wieviel Lohn die Marktbetreiber dem Produzenten für die Betätigung seiner Arbeitskraft zahlen, ist weitgehend unabhängig davon, wieviel Wert er produziert und wieviel davon ihnen als Mehrwert zusteht. Die Höhe des Lohns ist vielmehr abhängig davon, was als Wert der Arbeitskraft, als für die individuelle und generische Reproduktion des Arbeiters erforderliche Kostensumme gesellschaftlich gilt und akzeptiert wird. Und umgekehrt ist die Höhe des Mehrwerts abhängig davon, wie weit es den Marktbetreibern gelingt, einerseits die als Lohn erscheinenden Kosten für die Reproduktion der Arbeitskraft niedrig zu halten und andererseits den Produzenten zu einer möglichst effektiven Verausgabung der letzteren zu bewegen, sie als wertschöpfenden Faktor nach Kräften nutzbar zu machen.
Für beides bestehen zu Beginn der Neuzeit beste soziale und ökonomische Voraussetzungen. Erstens sorgen ein anhaltendes Überangebot an Arbeitskräften und ein entsprechender Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt dafür, dass die Marktbetreiber Lohndrückerei in großem Maßstab praktizieren und die Lohnarbeiter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen unterwerfen können. Und zweitens bewirkt das handelskapitale Engagement in der Produktionssphäre und die daraus folgende Überführung von Handels- in Industriekapital einen technischen Entwicklungsschub, einen Fortschritt in der Produktivität, der die zunehmende extensive Ausbeutung der Lohnarbeitskraft durch ein womöglich noch rascheres Wachstum ihrer intensiven Ausbeutung ergänzt und so den Marktbetreibern ermöglicht, exorbitant hohe Mehrwertraten zu erzielen und durch die Reinvestition der unverhältnismäßig hohen Profite in weitere und neue Produktionsprozesse die handwerkliche Produktionssphäre quasi im Fluge zu erobern und nach ihren vom Akkumulations- oder Verwertungsprinzip diktierten Vorstellungen umzugestalten.
So also führt die Verlagerung der Investitionstätigkeit der Marktbetreiber vom fertigen Produkt auf die Fertigungsfaktoren, sprich, die Transformation von Handelskapital, das seine Verkörperung in Waren findet, in Industriekapital, dessen Erscheinungsform die für die Warenerzeugung erforderlichen sächlichen und persönlichen Produktionsbedingungen sind, zu jener Umwälzung der gesellschaftlichen Reproduktion und Revolutionierung der auf letzterer aufbauenden Sozialstruktur, deren Ergebnis die kapitalistischen Gesellschaften unserer Tage sind. Der kapitale Wertschöpfungsprozess unterläuft den schönen Schein der durch Arbeit produzierten materialen Güter und entlarvt diese als Durchgangsmomente des sich selbst bezweckenden Werts. Die Wahrheit des Verwertungsparadigmas triumphiert über den Schein des Versorgungs- beziehungsweise Verteilungsparadigmas, mit dem Ergebnis einer das materielle Leben und sinnliche Dasein heimsuchenden Entwirklichung und Entwertung, die die den nachimperialen Gesellschaften von Gnaden der christlichen Religion gegebenen Objektmodelle und Verhaltensmuster außer Kraft zu setzen und gegenstandslos zu machen drohen.
Die Verlagerung der kommerziellen Tätigkeit von der fertigen Ware auf die Fertigung der Ware, sprich, die Entfaltung des kommerziellen Systems zu einem die Produktionssphäre einbeziehenden und sich assimilierenden industriellen Komplex, hat aber noch einen anderen Effekt, der weniger struktureller als kultureller oder weniger funktionaler als phänomenaler Natur und für unsere, um die Genese und Funktion von Ästhetik kreisenden Überlegungen unmittelbar relevanter ist. Gemeint ist die mit dieser Verlagerung einhergehende Revision und Neugewichtung der oben erläuterten und miteinander ebenso sehr verschränkten wie gegeneinander gleichgültigen Sichtweisen der Produzenten und der Marktbetreiber, derjenigen also, die den Markt beliefern und durch seine Vermittlung subsistieren, und derjenigen, die den Markt organisieren und mit seiner Hilfe akkumulieren.
Wie oben ausgeführt, verbinden die ersteren ja mit dem kommerziellen Austausch nichts anderes als das subsistenzielle Bedürfnis nach den zum Austausch kommenden Arbeitsprodukten, nichts weiter als das Interesse an der mittels Austausch effektuierten Distribution materialer Güter, wohingegen es den letzteren ausschließlich um den Austausch als solchen beziehungsweise das als Passepartout des Austauschs fungierende Austauschmittel, genauer gesagt, um dessen als Selbstzweck begriffene Akkumulation und Vermehrung zu tun ist. Damit stehen sich, wie gesagt, zwei Interessen oder Absichten gegenüber, die, wiewohl realiter miteinander vermittelt und nur durch die jeweils andere realisierbar, doch zugleich intentionaliter einander negieren und ausschließen.
Dabei bedeutet, wie ebenfalls dargestellt, diese unbeschadet der unauflöslichen faktischen Vermitteltheit der beiden Aktionen wechselseitige praktische Negation und Ausschließung der den Aktionen zugrunde liegenden Intentionen nicht etwa, dass letztere, substanziell genommen, ontologische Ebenbürtigkeit beziehungsweise, funktionell betrachtet, strukturalistische Gleichwertigkeit beanspruchen können. Schließlich wäre das subsistenzielle Bedürfnis nach materialen Gütern auch ohne deren Distribution durch kommerziellen Austausch vorhanden und würde nach Befriedigung verlangen, wohingegen das kommerzielle Streben nach Vermehrung des Austauschmittels jenes subsistenzielle Bedürfnis nach materialen Gütern zwingend voraussetzt und nur existiert und gedeiht, wenn und solange es das Bedürfnis zu befriedigen dient.
Insofern ist, wie oben konstatiert, die Negation und Gleichgültigkeit, mit der das subsistenzielle Bedürfnis dem kommerziellen Streben begegnet, die natürliche Haltung des realen Zwecks, der das funktionale Mittel, kaum dass es ihn, seinen Zweck, erfüllt hat, als den Mohren behandelt, der seine Schuldigkeit getan hat, sprich, es ad acta legt und dem Vergessen anheim fallen lässt, während die Indifferenz und Negativität, die das kommerzielle Streben dem subsistenziellen Bedürfnis beweist, diese Merkwürdigkeit und geradezu Absurdität besitzt, sich seines eigenen Grundes und Bodens entschlagen und in einer Art Münchhausenscher Selbstüberhebung seine irdische Basis zum verschwindenden Sprungbrett eines im autistischen Selbstbezug als idealische Selbstbegründung angestrebten unendlichen Zusichkommens machen zu wollen.
Natürlich eignet diesem unendlichen Zusichkommen, weil es, aller Selbstbegründungssuggestion zum Trotz, doch allemal von seinem endlichen Anfang abhängig bleibt, sprich, mit dem wiederkehrenden Rekurs auf seine als Sprungbrett missbrauchte irdische Basis steht und fällt, die im Bild vom Trampolinspringer gefasste schlechte Unendlichkeit eines bloß ewigen Strebens, das sich dem Bewusstsein seiner Vergeblichkeit und Widersinnigkeit durch die Flucht in schieren Wiederholungszwang entzieht. Aber das ändert nichts daran, dass in seiner schlechten Unendlichkeit solch idealisches Streben die irdische Basis arg kompromittiert, dass, für sich genommen und als maßgebende Perspektive akzeptiert, die kommerzielle Akkumulation dem subsistenziellen Austausch geradeso ins Gesicht schlägt und zur Verunstaltung oder Entstellung gereicht, wie ein Wahn das normale Leben, das alltägliche Dasein, wenn er auf der Grundlage und im Rahmen des letzteren wächst und gedeiht, wenn er es in den Nährboden und ins Baumaterial seiner bodenlosen Konstrukte und haltlosen Deutungen umfunktioniert, aus dem Lot bringt und in ein Vexierbild dessen, was er selber ist, verwandelt, sprich, es in den Wahnsinn treibt.
Dass der subsistenzielle Austausch so relativ unberührt von dieser in ihm sich breit machenden fixen Idee der kommerziellen Bereicherung bleibt, dass er den von Anbeginn seiner kommerziellen Fassung ihm innewohnenden Wahn so gut verkraftet und sich von ihm so wenig verunstalten und entstellen lässt, hat, wie ausgeführt, seinen Grund darin, dass der kommerzielle Wahn ihm eben nur innewohnt, unter der Oberfläche der Normalität und Alltäglichkeit des subsistenziellen Austauschs zwar da ist und sich fortspinnt, aber doch in der Latenz verharrt, die Normalität nicht durchbricht, den Alltag nicht stört. Weil, wie gesagt, die Akkumulation des Austauschmittels, des allgemeinen Äquivalents, immer wieder in eine Investition des Akkumulierten in neue Subsistenzmittel, materiale Güter einmündet und weil sie sogar gemäß der Entfaltung des Marktes, die sie bewirkt, eine qualitative Vervielfältigung und quantitative Vermehrung der materialen Güter, die ihr als Vehikel ihres idealischen Strebens, als Transportmittel ihres größenwahnsinnigen Selbstbezuges dienen, zur Folge hat, hält es nicht schwer, in praxi des Austauschs von ihr und ihrem latenten Irrsinn zu abstrahieren und den kommerziellen Austausch so anzusehen und zu behandeln, als wäre er in der Tat nichts als ein neutrales Instrument oder eine rationale Methode, den subsistenziellen Austausch unter im Zweifelsfall asymmetrischen Austauschbedingungen effektiv ins Werk zu setzen.
Genau diese Latenz des im kommerziellen Austausch wirksamen wahnhaften Akkumulationsdrangs aber droht jetzt aufzufliegen, droht durch die Verlagerung der handelskapitalen Investitionstätigkeit vom fertigen Produkt auf die Bedingungen seiner Produktion einem regelrechten Offenbarungseid zu erliegen. Indem die Marktbetreiber das als allgemeines Äquivalent firmierende Austauschmittel, um dessen Vermehrung es ihnen ausschließlich geht, den Geldwert, auf dessen Verwertung sie einzig und allein aus sind, nicht mehr in materiale Güter, sondern in die zu deren Erzeugung erforderlichen Faktoren und Komponenten stecken, lassen sie manifest und handgreiflich werden, was bis dahin verborgen bleibt und unter der Hand akzeptiert wird, dass nämlich aus ihrer irrsinnigen Perspektive die materialen Güter in specie und die irdischen Dinge in genere nichts weiter sind als verschwindendes Durchgangsmoment im Verwertungsprozess, nichts weiter darstellen als eine flüchtige Emanation oder kursorische Etappe bei der Überführung von Wert in mehr Wert, von Geld, das sich als Kapital entäußert und objektiviert, in Kapital, das sich, um ein Stück seiner selbst wundersam bereichert, als Geld wiederfindet und rekuperiert.
So gewiss die Marktbetreiber ihr als Handelskapital akkumuliertes allgemeines Äquivalent nicht mehr in die fertig produzierten materialen Güter, sondern gleich und unmittelbar in die Produktion dieser Güter, nämlich in die zur Produktion der Güter erforderlichen sächlichen Materialien und Werkzeuge und die zur Verarbeitung der Materialien und Betätigung der Werkzeuge nötige menschliche Arbeitskraft, mithin in dasjenige stecken, was den materialen Gütern überhaupt erst Wert vindiziert beziehungsweise in actu der durch Menschenhand oder persönliche Arbeitskraft vollbrachten sächlichen Wertübertragung Mehrwert verleiht, so gewiss stellen sie unmissverständlich klar, dass es ihnen in keiner Weise um die materialen Güter und deren subsistenziellen Austausch, sondern einzig und allein um die Erzeugung von Wert in Gestalt der materialen Güter und die Aneignung von Mehrwert mittels des Austauschs der Güter zu tun ist. Durch die Kapitalisierung der Produktionssphäre, dadurch also, dass sie Wert, allgemeines Äquivalent in die Mittel zur Produktion materialer Güter investieren, nur um dann den per Produktion auf die materialen Güter übertragenen und in ihnen verkörperten Wert mittels Zirkulation, mittels kommerziellem Austausch, gleich wieder als solchen zu rekuperieren, besser gesagt, als den mehrwertigen Wert, das akkumulierte Äquivalent, als das er sich dank Produktionsleistung, dank menschlicher Arbeit herausstellt, zu realisieren, machen die Marktbetreiber manifest und unübersehbar deutlich, dass die materialen Güter als solche keinerlei Bedeutung für sie besitzen, dass für sie selbst die materialen Qualitäten der Produkte, ihre Gebrauchseigenschaften, völlig irrelevant und die Produkte in der Tat nur die im Wertbildungsprozess ebenso sehr verschwindende wie verbindende Copula zwischen Produktionskosten und Profit aus dem Produzierten, zwischen dem in die Arbeit und ihre sächlichen Bedingungen investierten Wert und dem in den Produkten der Arbeit verkörperten und aus ihnen zirkulativ zu erlösenden vermehrten Wert sind.
Angesichts eines kommerziellen Austauschs, bei dem das allgemeine Äquivalent, um das beziehungsweise um dessen Akkumulation es den Marktbetreibern allein zu tun ist, den subsistenziellen Austausch, dem es an sich ja dient, nicht mehr als soziale Gegebenheit, als Konsequenz einer von den Mitgliedern der Gesellschaft betriebenen Arbeit, die das Subsistenzbedürfnis der Betreffenden ins Leben gerufen hat, empirisch vorfindet und voraussetzt, sondern als kapitale Veranstaltung, als Ausfluss eines die Mitglieder der Gesellschaft rekrutierenden Arbeitsbetriebes, den sein Selbstverwertungsstreben auf den Plan ruft, setzt und inszeniert – angesichts dieser als Wertschöpfungsprozess die materialen Güter unterlaufenden und durch sie hindurch sich vollziehenden Bewegung vom in die Produktion investierten Wert zum in der Zirkulation realisierten Mehrwert ist jede Möglichkeit dahin, noch weiterhin die Illusion einer mittels kommerzieller Investition verfolgten subsistenziellen Absicht zu kultivieren oder jedenfalls unter dem unmittelbaren Eindruck des handgreiflich beziehungsweise sinnenhaft subsistenziellen Austauschs das wahre Ziel der kommerziellen Investition aus dem Auge zu verlieren, und zeigt sich vielmehr das auf das allgemeine Äquivalent gemünzte kommerziell-kapitale Verwertungsparadigma dem auf die materialen Güter gerichteten subsistenziell-sozialen Verteilungsparadigma offen an die Seite oder vielmehr gegenüber gestellt und in seiner, aller empirisch-funktionellen Gleichzeitigkeit und Verschränktheit beider zum Trotz, systematisch-prinzipiellen Unvermitteltheit und Unvereinbarkeit mit letzterem ins Blickfeld beziehungsweise Rampenlicht gerückt.
Und nicht nur lässt sich das in der Selbstverwertung des Austauschmittels bestehende kommerzielle Paradigma hinter dem auf die Bedürfnisbefriedigung durch Güteraustausch zielenden subsistenziellen Paradigma nicht mehr verbergen und zum Verschwinden bringen, es droht gleich auch und mehr noch dem letzteren den Rang abzulaufen und sich als herrschende Perspektive, als Paradigma stricto sensu, zur Geltung zu bringen. So groß ist eben dank der Verlagerung der Investition vom fertigen Produkt auf die Produktionsbedingungen, dank mit anderen Worten der Überführung des Handelskapitals in industrielles Kapital, in als Wert, der sich selbst verwertet, bestimmtes Kapital sans phrase, die Dynamik, die die dergestalt auf die Produktionssphäre selbst übergreifende und in sie eingreifende kommerzielle Tätigkeit entfaltet, und eine solche Präsenz und in der Tat Allgegenwart gewinnt auf diese Weise die durch den subsistenziellen Austausch hindurch als kommerzieller Selbstzweck betriebene Vermehrung und Anhäufung des Austauschmittels, dass angesichts solcher Omnipräsenz des kommerziellen Verwertungsparadigmas das subsistenzielle Verteilungsparadigma, weit entfernt davon, das erstere noch kaschieren und sich integrieren zu können, im Gegenteil als dessen bloßes Anhängsel, als seine nicht minder korollarische als unvermeidliche Begleiterscheinung figuriert.
Auch wenn unverändert gilt, dass ohne das als subsistenzieller Austausch praktizierte Verteilungsparadigma das im kommerziellen Austausch wirksame Verwertungsparadigma nicht existieren, geschweige denn funktionieren kann, ist doch das letztere nun so mit Händen zu greifen und beweist solch ein Entfaltungspotenzial, dass es in Sachen phänomenale Sichtbarkeit und empirische Evidenz den Spieß herumzudrehen droht und, statt im Schatten des ersteren seinem Geschäft nachzugehen und sein Interesse zu wahren, Miene macht, es vielmehr in den Schatten zu stellen beziehungsweise zum zweitrangigen Ereignis zu degradieren, sprich, die subsistenzielle Verteilung als bloßen Ausfluss oder zwangsläufigen Nebeneffekt des kommerziellen Verwertungsgeschäfts erscheinen zu lassen.
Und in dem Maße, wie das geschieht und die beiden Paradigmata ihre relative Relevanz und Evidenz verändern und quasi die Plätze tauschen, droht nun natürlich auch die oben dem Verwertungsparadigma als illusionäre Perspektive, als realitätsfeindlicher Wahn attestierte idealische Projektion eine ganz andere Bedeutung und Virulenz zu erlangen und das Verteilungsparadigma beziehungsweise dessen Inhalt, die materialen Güter des menschlichen Lebens in specie und die realen Verhältnisse des weltlichen Daseins in genere, auf ganz andere Weise zu affizieren, will heißen, in ihren Wahncharakter, ihre Realitätsferne und illusionäre Verstiegenheit zu verstricken. Wie oben ausgeführt, tendiert der im kommerziellen Austausch implizierte akkumulative Selbstbezug oder autistische Größenwahn des Austauschmittels dazu, die irdische Basis des kommerziellen Austauschs, den subsistenziellen Austausch und seinen materialen Inhalt und Zweck, quasi aufzuheben und in ein bloßes Durchgangsmoment beziehungsweise katalytisches Ferment, in nichts weiter als einen Steigbügelhalter beziehungsweise ein Sprungbrett seiner münchhausenschen Verstiegenheit umzufunktionieren, mithin dieser irdischen Basis ihre begründende Stellung und haltgebende Funktion zu verschlagen und sie der Entwirklichung und Entwertung zu überantworten, die jene größenwahnsinnige Perspektive des allgemeinen Äquivalents, jene ihm eingefleischte Selbstzweckillusion für sie bereithält. Und wie ebenfalls konstatiert, bleibt diese Entwirklichung und Entwertung, der seine Verwandlung aus dem unmittelbaren Zweck des kommerziellen Austauschs in ein Durchgangsmoment, ein bloßes Mittel des sich als Selbstzweck etablierenden Austauschmittels, den irdischen Grund, den subsistenziellen Austausch aussetzt, nur deshalb außer Betracht und gewinnt nur deshalb keine die Wahrnehmung prägende Relevanz, weil der kommerzielle Austausch sich in dem vom subsistenziellen Austausch gesteckten Rahmen und vor allem hinter der vom subsistenziellen Austausch gebildeten Camouflage vollzieht.
Bedeuten da nun nicht die Ausdehnung des kommerziellen Austauschs auf die dem subsistenziellen Austausch vorausgesetzte Produktionssphäre, die Kapitalisierung der für die Erzeugung des Inhalts des subsistenziellen Austauschs, der materialen Güter, verantwortlichen Arbeit und Arbeitsmittel, und die den Schein von subsistenzieller Materialität durchbrechende unmittelbare Sichselbstgleichheit, die das als Kapital agierende allgemeine Äquivalent hierbei gewinnt, zwangsläufig eine Emanzipation und Manifestation des kommerziellen Austauschs, die ihn der Obliquität und Verborgenheit, in der ihn der subsistenzielle Austausch bis dahin verhält, definitiv entreißt und, indem sie ihn dem letzteren ebenso gleichberechtigt wie unübersehbar an die Seite stellt oder sogar als dem subsistenziellen Austausch übergeordnetes und für die Realitätswahrnehmung maßgebendes Paradigma oktroyiert, nolens volens die vom hiernach zweitrangigen Paradigma des subsistenziellen Austauschs hochgehaltene irdische Wirklichkeit und weltliche Materialität als solche in Misskredit bringt und nurmehr in der korollarischen Bedeutung und kursorischen Funktion gelten zu lassen droht, die der zum Paradigma stricto sensu avancierte kommerzielle Austausch ihr beimisst und zuweist?
Und es ist nun – womit wir endlich nach langem Umweg zu unserem Thema, der Ästhetik, zurückkehren! – genau diese Aushöhlung und Verflüchtigung, diese Entwirklichung und Entwertung, die der Wahrnehmung der Materialität des menschlichen Daseins in specie und dem Umgang mit der Objektivität der weltlichen Dinge in genere von Seiten eines die Materialität und Objektivität zum Durchgangsmoment oder transitorischen Mittel seines projektiven Selbstbezuges, seines größenwahnsinnigen Strebens nach Selbstvermittlung degradierenden, weil unverhohlen seine Selbstverwertung betreibenden, sprich, sein wahres Wesen offenbarenden und sich als industrieller Automat, als Kapital in Szene setzenden kommerziellen Wertes droht – genau diese den materialen Dingen und irdischen Bezügen drohende Entwirklichung und Entwertung ist es nun, was die neuzeitlichen Gesellschaften zwingt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen und eine dem Vorgehen in der antiken Handelsstadt vergleichbare Strategie zu verfolgen, sprich, durch die Schaffung allgemeiner Wahrnehmungsmodelle und Verhaltensmuster, die Einführung explizit ästhetischer Modelle und Muster, der bedrohten materialen Wirklichkeit und irdischen Lebenswelt Sukkurs zu leisten.
Freilich, höchstens von Ähnlichkeit, mitnichten von Identität kann im Blick auf die Umstände, die in den neuzeitlichen Gesellschaften und in der antiken Handelsstadt jeweils zur Ausbildung einer als gesellschaftliche Einrichtung beziehungsweise Veranstaltung eigenständigen Ästhetik führen, die Rede sein. Bei aller oberflächlichen Parallelität der die neuzeitlichen Gesellschaften heimsuchenden Krise und der in der antiken Handelsstadt eintretenden Notlage liegen die sowohl in topischer als auch in dynamischer Hinsicht wesentlichen Differenzen zwischen neuzeitlicher und antiker Situation auf der Hand.
In der antiken Situation ist es, wie oben dargestellt, die Entstehung eines handelsstädtisch-marktwirtschaftlichen Systems als solche, die, weil sie durch die als Wert oder Pretium bestimmte neue, quantitative Identität, die sie den Dingen und Verhältnissen verleiht, einen radikalen Bruch mit den traditionellen, durch die Heroen- und Götterkulte der territorialherrschaftlich-agrarwirtschaftlichen Ordnung sanktionierten Sicht- und Verhaltensweisen und der durch sie der irdischen Welt und dem menschlichen Dasein qua Typus oder Paradigma vindizierten qualitativen Beschaffenheiten bewirkt und, da sie keinen Ersatz für die qualitativen Beschaffenheiten zu bieten, nichts Passendes an die Stelle der fürs konsumtive und kommunikative gesellschaftliche Leben außerhalb des Marktes unabdingbaren Wahrnehmungstypen und Verhaltensparadigmata treten zu lassen vermag, die Wahrnehmung und das Verhalten der Mitglieder der Gesellschaft um ihre Allgemeinheit und Verbindlichkeit zu bringen und der Partikularisierung und Auflösung auszuliefern droht.
Um dieser Bedrohung zu begegnen, bleibt der antiken handelsstädtischen Gesellschaft nichts anderes übrig, als auf die der alten, territorial- herrschaftlich-agrarwirtschaftlichen Religion entsprungenen Modelle und Muster zurückzugreifen, die freilich, weil sie durch die handels- städtisch-marktwirtschaftliche Ordnung ja außer Kraft gesetzt und abgedankt sind, einer als Anpassung an die Interessen und das Selbstverständnis der handelsstädtischen Gesellschaft wohlverstandenen Überarbeitung und Umfunktionierung, kurz, einer Ästhetisierung bedürfen, wobei es, wie gezeigt, der Polisgesellschaft gelingt, diesen Prozess einer poliskonformen Uminterpretation der alten sakralen Mächte und Umrüstung ihrer traditionellen Kulte und Rituale auf ebenso komplizierte wie raffinierte Weise ausgerechnet durch die in die Handelsstadt integrierten politischen Vertreter der alten Ordnung, die landbesitzende Aristokratie, und mit deren ökonomischen Mitteln ins Werk setzen zu lassen.
Von solcher Notwendigkeit einer als Ästhetisierung erscheinenden Revision und Zurichtung der überlieferten religiösen Objektvorstellungen und Verhaltensnormen aber ist die Neuzeit weit entfernt. Wie gesehen, bringt es die für die nachimperiale Zeit, das so genannte Mittelalter, grundlegende, christliche Religion in der abgründigen Negativität, mit der sie dem irdischen Leben und menschlichen Dasein als ganzem begegnet, mit sich, dass die Art und Weise, wie sich die Gesellschaften, aller heilsperspektivischen Weltfluchtmotion zum Trotz, zum irdischen Leben stellen und im menschlichen Dasein einrichten, in ihren primären Bestimmungen nicht an einen spezifischen politisch-ökonomischen Modus beziehungsweise praktisch-empirischen Duktus dieses Lebens und Daseins gebunden ist, sondern gratia dei zustande kommt und sich nämlich als Nachfolge Christi ins Werk setzt, sprich, ihre Konstitution und Grundformen den Modalitäten und Befindlichkeiten der im Leben des Erlösers modellhaft und mustergültig Gestalt gewordenen heilsperspektivischen Biographie entnimmt. Auch wenn diese, im Wesentlichen durch den Heilssuchertypus und das Heilsbringerparadigma des Lebens des Herrn geprägte Stellung zur Welt und Einrichtung im Dasein sich dann je nach Lebensbereich und politisch-ökonomischen Umständen spezifizieren und konkretisieren, also in den als feudale Gesellschaften sich organisierenden territorialherrschaftlich-agrarwirtschaftlichen Verbänden und in den als kommunale Gemeinschaften sich parallel dazu zusammenfindenden handelsstädtisch-marktwirtschaftlichen Gruppierungen ganz differente oder auch divergierende Funktionsbestimmungen und Erscheinungsformen ausbilden – beiden gesellschaftlichen Formationen sind die den jeweiligen objektiven Gegebenheiten und subjektiven Bedürfnissen ihrer Mitglieder angepassten typologischen Bestimmungen und Paradigmata gleich unmittelbar gegeben und als originäre Errungenschaften zu eigen, was ja auch im Einklang mit der historischen Tatsache erscheint, dass, anders als zu Zeiten der Antike, in der postimperialen Situation die kommerziell organisierte handwerklich-städtische Gemeinschaft nicht aus einer ihr vorausgesetzten, territorialherrschaftlich verfassten agrarischen Gesellschaft, von der sie sich emanzipieren und gegen die sie sich behaupten muss, hervorgeht, sondern dass hier beide Vergesellschaftungsformen, die marktwirtschaftliche Gemeinschaft und die agrarwirtschaftliche Gesellschaft, gleichzeitig entstehen und sich, aller symbiotischen Verknüpfung unbeschadet, in chronischer Parallelität entwickeln.
Die marktwirtschaftliche Gemeinschaft der als Mittelalter apostrophierten nachimperialen Zeit leidet also keineswegs wie die der Antike an einem Mangel an Objektmodellen, die der individuellen Wahrnehmung Allgemeinheit verleihen, und an Verhaltensmustern, die die Verbindlichkeit des kommunalen Habitus garantieren, und ist also auch nicht wie jene gezwungen, diese Modelle und Muster aus der religiösen Tradition der territorialherrschaftlichen Gesellschaft zu übernehmen und, um sie übernehmen zu können, in ihrer Erscheinungsform und Geltungsweise zu revidieren und umzufunktionieren, kurz, zu ästhetisieren.
Die ihr als originäres religiöses Erbe gegebenen, ihr gratia dei eigenen Objektmodelle und Verhaltensmuster revidieren und umfunktionieren muss freilich auch sie – und damit sind wir beim zweiten wesentlichen Unterschied zwischen ihr und ihrer antiken handelsstädtischen Vorgängerin! Zwar leidet die marktwirtschaftliche Gemeinschaft der beginnenden Neuzeit in der Tat keinen Mangel an die Beziehung zur Realität normierenden epistemischen Modellen und das kommunale Verhalten regulierenden praktischen Mustern, dafür aber tendiert sie dazu, die Modelle und Muster, über die sie gratia dei, kraft originärer und an ihre spezifischen Lebensbedingungen angepasster religiöser Tradition, verfügt, durch die ökonomische Entwicklung, die sie durchläuft, selber außer Kraft zu setzen beziehungsweise gegenstandslos werden zu lassen.
Wie gezeigt, bringt es die Dynamik des Fortgangs der neuzeitlich-marktwirtschaftlichen Gemeinschaft von der handelskapitalen zur produktionskapitalen Akkumulation, sprich, von einem kommerziellen Wert- abschöpfungsprozess, der sich darauf beschränkt, am Wert der von einer eigenständigen Produktionssphäre erzeugten Güter zu partizipieren, zu einem industriellen Wertschöpfungsprozess, der sich darauf verlegt, die Produktionssphäre selbst dem Markt zu integrieren und dessen Streben nach Mehrwert faktorell zu unterwerfen und funktionell anzupassen – wie gesehen, bringt es diese Dynamik mit sich, dass die Degradierung der menschlichen Materialität in specie und der weltlichen Realität in genere zum bloßen Durchgangsstadium und verschwindenden Moment, mithin die Entwertung der Materialität und Entwirklichung der Realität, die der kommerzielle Akkumulations- und Verwertungsprozess von Haus aus immer schon impliziert, aus einer bis dahin latenten Tatsache, eben einer bloßen Implikation, zu einer manifesten Gegebenheit, einem expliziten Datum zu werden droht.
Die Einbindung der materialen Güter in specie und der irdischen Dinge in genere in einen Prozess, der von A bis O als Verwertungsprozess, als wiederholungsträchtig um die Vermehrung des allgemeinen Äquivalents mittels der Erzeugung besonderer Wertgestalten kreisender Zirkel zutage liegt und erkennbar ist, macht, was bis dahin stillschweigende Kondition und heimliche Klausel der materiellen Reproduktion der ihre Distribution kommerziell, über den Markt, betreibenden Gesellschaften war, zum nicht nur aktuell offenen Geheimnis, sondern mehr noch tendenziell erklärten Telos dieser Reproduktion. Weil der durch Integration der Produktionssphäre in das Marktgeschehen sich zum spiralig geschlossenen Zirkel verselbständigende Verwertungsprozess zum maßgebenden Paradigma gesellschaftlichen Handelns zu avancieren und das unmittelbare Medium der gesellschaftlichen Reproduktion, den subsistenziellen Austausch, zu einer bloßen Nebenerscheinung beziehungsweise fortlaufend verschwindenden Etappe zu verflüchtigen droht, zeigt sich der Inhalt und Gegenstand des subsistenziellen Austauschs, zeigen sich die materialen Güter und realen Bezüge in die Verflüchtigung hineingezogen und sehen sich die in ihrem Leben außerhalb des Marktes auf diese Inhalte und Gegenstände angewiesenen und an ihnen ihre Subsistenz und Befriedigung findenden Menschen dem Eindruck konfrontiert, sich auf, ontologisch gefasst, Unwirkliches, Schimärisches zu beziehen oder an, essentiologisch genommen, Beiwerk, Wertlosem festzumachen. Ästhetisierung bedeutet jetzt die Ersetzung der ontologisch-fundamentalen Aufgabe, die die religiösen Archetypen und Paradigmata traditionell erfüllen, durch eine empiriologisch-funktionale Zielsetzung: Die ästhetischen Kategorien und Normen dienen dazu, der durch den Wertschöpfungsprozess heraufbeschworenen Entwirklichung und Entwertung der Dinge und Verhältnisse zu wehren und deren Bestand und Beständigkeit zu reaffirmieren. Kunst ist also nicht mehr wie in der Antike eine epistemische und moralische, sondern eine exegetische und ideologische Veranstaltung. Wegen der Unaufhaltsamkeit des kapitalen Verwertungsprozesses schließt die der Ästhetik abgeforderte objektive Reaffirmationsleistung eine chronische oder historische Dimension ein: Die Kunst ist zu ständiger Anpassung an den Prozess gezwungen und hat gleichermaßen konservatorischen und antizipatorischen Charakter. Ausdruck der gegenüber der Antike veränderten Aufgabenstellung der Kunst ist der Wechsel von der Plastik zur Fläche, die Ersetzung der Bildhauerei durch die Malerei in der Rolle der Leitdisziplin.
Und es ist nun genau dieser Eindruck einer von Seiten des manifesten kommerziellen Paradigmas dem materiellen Leben und sinnlichen Dasein drohenden Entwirklichung und Entwertung, was die Betroffenen zwingt, auf die traditionellen religiösen Objektkategorien und Beziehungsarten, die vom christlichen Glauben für die irdische Existenz zur Verfügung gestellten Wahrnehmungsformen und Verhaltensweisen zu rekurrieren, um durch sie die von Substanzverlust und Haltlosigkeit heimgesuchte menschliche Materialität und Sinnenwelt zu reaffirmieren und zu stabilisieren, ihr, der vom kapitalen Verwertungsprozess entwurzelten und mitgerissenen, in die Flucht geschlagenen und der Schwindsucht preisgegebenen Erscheinungswelt und irdischen Empirie, ihre Substanz und Kontinuität zu sichern, Bestand und Beständigkeit zu verleihen. Sie, die herkömmlicherweise gratia dei das menschliche Leben sanktionierenden und das weltliche Dasein orientierenden Modelle und Muster, werden bemüht, der durch den spiraligen Zirkel des Verwertungsprozesses die Dinge und Verhältnisse ergreifenden Scheinhaftigkeit und Flüchtigkeit zu wehren und sie als nach wie vor substanzielle Gegebenheiten gutzusagen, sie in ihrer unverändert materialen Geltung zu garantieren. Damit freilich erfahren die religiösen Modelle und Muster einen Bedeutungs- und Funktionswandel, der durchaus dem vergleichbar ist, den in der Antike die götterkultlichen Archetypen und Paradigmata durchlaufen, und der sich wie dieser als ein Vorgang, strukturell gesehen, der Säkularisierung beziehungsweise, funktionell betrachtet, der Ästhetisierung beschreiben lässt.
Ursprünglich oder unmittelbar ist es ja Aufgabe der dem Erdenleben des Herrn entlehnten, sprich, als religiöse introduzierten Wahrnehmungsmodelle und Verhaltensmuster, gegen die weltflüchtige und daseinsverneinende Perspektive der christlichen Heilsbotschaft einen Modus vivendi zu etablieren und aufrecht zu erhalten, sprich, das Warten auf die Erlösung vom irdischen Dasein und auf den Eintritt ins ewige Leben mit dem Bedürfnis und Anspruch in Einklang zu bringen, sich bis dahin im irdischen Dasein eine Bleibe zu schaffen, sich in der innerweltlichen Wirklichkeit häuslich einzurichten. Nun hingegen droht eben dieses irdische Dasein, diese weltliche Realität, worin sich die Gesellschaft häuslich eingerichtet hat, der Negation des durch ihre Distributionsform, den Markt, entfesselten Verwertungsprozesses zu verfallen und in dessen als wahnhafte Selbstvermittlungsaktion offen erscheinender Fluchtperspektive ihrer Substantialität und Kontinuität verlustig zu gehen. Wenn deshalb jetzt die tradierten Wahrnehmungsmodelle und Verhaltensmuster aufgeboten und ins Feld geführt werden, dann nicht mehr gegen die – je nach biographischem Standort – winkende Verheißung oder drohende Aussicht einer heilsperspektivischen Transzendenz, sondern gegen den – je nach ökonomischem Interesse – lockenden Wertgewinn oder drohenden Wirklichkeitsverlust, den der daseinsimmanente Kapitalisierungsprozess mit sich bringt. Sie erfüllen keine transzendentale Funktion mehr, sondern verfolgen rein immanente Absichten, haben mit anderen Worten nicht mehr die Aufgabe, das menschliche Dasein ontologisch zu begründen und zu garantieren, sondern dienen bloß dem Zweck, es empiriologisch zu bekräftigen und zu affirmieren.
Mit dieser Grundfigur der Ersetzung einer ontologisch-fundamentalen Aufgabenstellung durch eine empiriologisch-funktionale Zielsetzung, des Übergangs vom Anspruch einer Bewältigung religiös-transzendentaler Herausforderungen zum Versuch einer Lösung säkular-immanenter Probleme, kurz, der Überführung kultischer Archetypen und Paradigmata in ästhetische Normen und Regulative endet freilich auch schon die Parallele zwischen den Wahrnehmungsmodellen und Verhaltensmustern der Antike und der Neuzeit, in diesem prinzipiellen Punkte einer aus der Religion hervorgehenden und sich von ihr emanzipierenden ästhetischen Disziplin erschöpft sich die epochale Übereinstimmung. Schaut man näher hin, treten die effektiven Unterschiede in der Beschaffenheit und Funktionalität der hier wie dort als eigenständige gesellschaftliche Tätigkeit und Einrichtung in Erscheinung tretenden Ästhetik zutage, was angesichts der Verschiedenheit der Probleme, mit deren Lösung sie jeweils betraut ist, schwerlich verwundern kann.
Wie oben gezeigt, ist in der antiken Handelsstadt die Ästhetisierung der religiös tradierten Archetypen und Paradigmata Folge der Tatsache, dass die handelsstädtische Gemeinschaft durch die andere, als Wert oder Pretium bestimmte, wesentlich quantitative Identität, die sie mittels ihres neuen Distributionssystems, des Marktes, den Dingen und Verhältnissen verleiht, jene der alten, territorialherrschaftlichen Gesellschaftsordnung entspringenden und zugehörigen Archetypen und Paradigmata suspendiert und außer Kraft setzt, ohne doch aus Eigenem über entsprechende qualitative, im Dasein außerhalb des Marktes, im konsumtiven Sozialleben, einheitsstiftende Objektbestimmungen und Konsens gewährleistende Umgangsformen zu verfügen. Gegenüber der nunmehr marktvermittelten Realität fehlt es dem kommunalen Kollektiv an gemeinschaftseigenen Kategorien oder Anschauungsformen, die der Objektwahrnehmung Allgemeingültigkeit sichern, und an originären Ritualen oder Verhaltensweisen, die dem sozialen Handeln Verbindlichkeit verleihen könnten, und deshalb sieht sich das Kollektiv von epistemischer Partikularisierung bedroht beziehungsweise findet sich die Kommune der Gefahr moralischer Auflösung ausgesetzt. Diese Bedrohung und Gefahr bannt sie durch Rückgriff auf die der alten, territorialherrschaftlichen Gesellschaftsordnung zugehörigen religiösen Wahrnehmungsformen und rituellen Verhaltensweisen, die sie allerdings, um sie unter den neuen Bedingungen der Handelsstadt in Gebrauch nehmen zu können, auf die geschilderte umständliche Weise dem Leben und Treiben der Polisgemeinschaft anpassen, sprich, säkularisieren und ästhetisieren muss.
Der handelsstädtischen Gemeinschaft des späten Mittelalters und der beginnenden Neuzeit fehlt es nicht an solchen, dem Leben und Treiben in der städtisch-marktwirtschaftlichen Gemeinde objektive Allgemeinheit und regulative Verbindlichkeit vermittelnden Wahrnehmungsmodellen und Verhaltensmustern. Sie sind ihr aufgrund ihrer religiösen Fundierung in einem heilsperspektivisch-erlöserkultlichen Jenseitsglauben, der gratia dei, genauer gesagt, dank des Erdenwandels des göttlichen Erlösers, einen für das wie immer transitorische Leben im Diesseits tauglichen modus vivendi zur Verfügung stellt, originär gegeben – und zwar ebenso originär wie der bäuerlich-territorialherrschaftlichen Gesellschaft, mit der sie, die handwerklich-handelsstädtische Gemeinschaft, gemeinsam und so gut wie gleichzeitig aus den Trümmern des Römischen Reiches hervorgeht, um sich wie diese im Erwartungshorizont der neuen Religion zuerst noch eher provisorisch und dann zunehmend häuslicher auf Erden einzurichten. Was ihr zu schaffen macht, ist kein Mangel an normativen Objektkategorien und paradigmatischen Arten, sich zu verhalten, sondern das Problem, diesen durchaus vorhandenen Wahrnehmungskategorien und Verhaltensweisen ihren faktischen Bezug zu sichern und ihre praktische Geltung zu bewahren – ihren Bezug auf und ihre Geltung für eine Realität nämlich, die von der als kapitalistischer Verwertungsprozess funktionierenden beispiellosen Dynamisierung des Marktsystems erfasst wird und im Sog jenes Prozesses ihrer Substantialität und Kontinuität verlustig zu gehen, sprich, in ihrem materialen Bestand und ihrer realen Beständigkeit unterminiert und disqualifiziert zu werden droht.
Ist also in der Antike das Problem eher das subjektrelativ-epistemolo- gische, dass durch die historische Entstehung des Marktsystems die zuvor Geltung und Verbindlichkeit beanspruchenden Wahrnehmungkategorien und Verhaltensnormen den Mitgliedern der Gesellschaft abhanden kommen und deshalb deren Wahrnehmung und Verhalten in Gefahr stehen, sich zu partikularisieren und monadisch aufzulösen, so ist das Problem jetzt eher das objektspezifisch-ontologische, dass durch die systematische Entwicklung des Marktsystems, seine kapitalistische Wendung, den Wahrnehmungskategorien und Verhaltensnormen, die dem System traditionell zu eigen sind, die Realität und Wertbeständigkeit verloren zu gehen droht. Und geht es folglich dort darum, mittels der dem territorialherrschaftlich-agrarwirtschaftlichen Zusammenhang entlehnten Archetypen und Paradigmata der Wahrnehmung und dem Verhalten ihre durch den Paradigmenwechsel, den das Marktsystem darstellt, bedrohte kommunikative Allgemeingültigkeit und kommunale Verbindlichkeit zu sichern, so ist hier vielmehr die Aufgabe, mittels der im Marktsystem selbst durchaus vorhandenen Kategorien der Wahrnehmung und Normen des Verhaltens die Gegenständlichkeit zu substantiieren und die praktischen Verhältnisse zu reaffirmieren, die das Marktsystem durch seine den Reproduktionsprozess der Gesellschaft kapitalisierende eigene Dynamik sich anschickt, der Wahrnehmung entgleiten zu lassen und dem Verhalten zu verschlagen.
Die hier wie dort dem traditionellen religiösen Kontext entnommenen und zur Bewältigung aktueller säkularer Probleme der Gesellschaft instrumentalisierten, sprich, ästhetisierten Kategorien und Normen haben also hier eine wesentlich andere Funktion als dort: Sie dienen nicht mehr dazu, die durch das marktwirtschaftliche System und seinen Paradigmenwechsel der Desorientierung ausgesetzten Wahrnehmungen und der Privatisierung ausgelieferten Haltungen konsensfähig und als kommunal verbindliche in Geltung zu erhalten, sondern verfolgen den Zweck, die kraft des marktwirtschaftlichen Systems und seiner Entwicklungsdynamik der Abstraktion und Schwindsucht verfallenden, sprich, von Entrealisierung und Entqualifizierung betroffenen materialen Dinge und sozialen Verhältnisse selbst als allgemein geltende Tatbestände der Wahrnehmung vor Augen zu führen und als verbindlich bleibende Organisationsstrukturen dem Verhalten vorzuschreiben.
Dort ist die Entstehung einer von der Religion unabhängigen, säkularen Ästhetik eher Erfordernis des durch das Marktsystem veränderten und um seine traditionelle Weltsicht gebrachten Bewusstseins, das sich mit Hilfe dieser im Einklang mit dem Marktsystem revidierten traditionellen Weltsicht neu auf die Wirklichkeit einstellen muss, hier ist sie eher Gebot einer sich durch den Verwertungsprozess, zu dem das Marktsystem totalisiert erscheint, verändernden und ihre Haltbarkeit und Fasson verlierenden Wirklichkeit, die mittels der in Reaktion auf jenen Verwertungsprozess aktualisierten traditionellen Sicht- und Verhaltensweisen für das Bewusstsein fasslich und annehmbar gemacht werden muss.
Der sich von der Religion emanzipierenden und als eigenständige gesellschaftliche Einrichtung etablierenden Kunst fällt also nicht mehr wie in der Antike eine epistemische oder moralische Funktion, sondern eine exegetische oder ideologische Rolle zu, sie soll nicht mehr sowohl die Allgemeinheit und Verbindlichkeit der sozialen Wahrnehmung und des kommunalen Verhaltens gewährleisten, als vielmehr für die Wahrnehmung und das Verhalten den Bestand und die Beständigkeit der objektiven Erscheinungen und praktischen Beziehungen sichern. Noch einmal anders ausgedrückt und eher gesellschaftspolitisch als weltanschaulich gefasst, dient die Ästhetik nicht mehr dazu, dem der Handelsstadt drohenden Sittenverfall und einem zur Idiotie tendierenden Egoismus des maßgebenden Bewusstseins entgegenzutreten, sondern konzentriert sich darauf, dem der Marktgesellschaft ins Haus stehenden Sinnverlust und einer zur Monomanie geratenden Abstraktheit des herrschenden Seins Einhalt zu gebieten.
Dabei impliziert diese als Wechsel von der Subjektkonstitution zur Objektstiftung oder von der Epistemologie zur Phänomenologie charakterisierbare Differenz der neuzeitlichen zur antiken Ästhetik, diese ihre Differenz in der Aufgabenstellung, auch und natürlich eine unterschiedliche Prozessualität und Entwicklungsperspektive. Im antiken Fall geht es ja nur darum, den einmaligen Paradigmenwechsel zu bewältigen, mit dem der Übergang von der agrarisch-territorialherrschaftlichen Gesellschaft zur städtisch-marktwirtschaftlichen Gemeinschaft das Bewusstsein der Betroffenen konfrontiert. Ist dies vollbracht und ist es also gelungen, den Verlust und Mangel an das konsumtive Sozialleben normierenden Objektvorstellungen und regulierenden Verhaltensweisen durch die säkulare Umgestaltung und ästhetische Wiederaufnahme der vom Marktsystem suspendierten Archetypen und Paradigmata der territorialherrschaftlichen Kulte und Rituale zu kompensieren, so ist die Sache abgeschlossen, und es bedarf keiner weiteren, das Bewusstsein betreffenden Formierungsanstrengung und Anpassungsleistung.
In der neuzeitlichen Situation hingegen ist das, was das Bewusstsein inkommodiert, eine seine bewährten Wahrnehmungsformen und Verhaltensweisen unterminierende und entkräftende fortlaufende Funktionalisierung und Zweckentfremdung der wahrgenommenen Wirklichkeit und der Verhältnisse, auf die das Verhalten gemünzt ist, selbst, und von daher ist, wenn die religiös bewährten Objektvorstellungen und tradierten Verhaltensmuster in säkularisierender Absicht und ästhetisierender Bedeutung aufgeboten werden, um der im Fluchtpunkt ihrer heteronomen Funktionalität zu verschwinden drohenden Wirklichkeit ihren Bestand zu sichern und den in der Konsequenz ihrer Zweckentfremdung auf instabile, wechselnde Konstellationen reduzierten Verhältnissen Beständigkeit zu verleihen, dies kein ebenso einmaliges wie entscheidendes Ereignis, sondern ein ebenso fortlaufender wie unabschließbarer Prozess – nämlich geradeso fortlaufend wie die Entwirklichung und Entwertung, die jene Funktionalisierung und Zweckentfremdung der Welt und ihrer Organisationsstrukturen zum Vehikel kapitalistischer Verwertung mit sich bringt, und geradeso unabschließbar, wie es die in die schlechte Unendlichkeit ihrer spiraligen Zirkelhaftigkeit gebannte kapitalistische Verwertung selbst ist.
Als gegen die Schwindsucht einer Wirklichkeit, die sich durch ihre kapitalistische Fremdbestimmung um ihre Sichselbstgleichheit, ihr substanzielles Sein gebracht und zum kursorischen Mittel und selbstverleugnenden Durchgangsmoment eines leerlaufenden Verwertungsprozesses ebenso sehr degradiert wie funktionalisiert findet – als gegen diese Schwindsucht aufgebotenes Substantiierungsvorhaben und Stabilisierungsunternehmen muss die neuzeitliche Ästhetik dem, wogegen sie Stellung bezieht und zu stehen beansprucht, doch zugleich Folge leisten und Tribut zollen. So gewiss sie dem die materiale Welt und die realen Verhältnisse in seinen Sog ziehenden kapitalen Treiben Einhalt gebieten will, so gewiss muss sie aber auch fortlaufend mit ihm Schritt halten. Sie kann nicht einfach auf ihrer Gegenposition, ihrer gegen die Kursorik des Verwertungsprozesses geltend gemachten Banntätigkeit beharren, sondern muss der Entwicklungsdynamik jenes Prozesses Rechnung tragen, muss in immer neu widerständiger Form die Dynamik aufnehmen und in die von ihr negierte Kontinuität und Stabilität rücküberführen, in ruhende Energie, in Statik, verwandeln.
Dieser Umstand, dass hier kein einmaliger Paradigmenwechsel von der territorialherrschaftlich-agrarischen Ordnung zum marktwirtschaftlich-städtischen System stattfindet, sondern dass sich das marktwirtschaftlich-städtische System als solches zu einem weltverändernden, die menschliche Reproduktion revolutionierenden kapitalistischen Verwertungsprozess als einem Prozess der Verwertung wertbildender Arbeit durch den von ihr gebildeten Wert selbst, ihr als Kapital in ihr sich reproduzierendes eigenes Resultat, entfesselt zeigt, begründet den zweiten wesentlichen Unterschied der neuzeitlichen Ästhetik zur antiken.
Nicht nur, dass hier die von der Ästhetik aus dem religiösen Kontext herausgelösten und für säkulare Zwecke in Anspruch genommenen Anschauungsformen und Paradigmata nicht mehr sowohl einer auf das gesellschaftliche Bewusstsein gerichteten epistemologisch-pädagogischen, die Wahrnehmung und das Verhalten orientierenden Aufgabe dienen, sondern einen auf das gesellschaftliche Sein selbst gemünzten phänome- nologisch-ideologischen, die Wirklichkeit und ihren Wert interpretierenden Zweck erfüllen – die Tatsache, dass die Neuerung und Veränderung, gegen die jetzt die Ästhetik aufgeboten wird, im Unterschied zum einfachen Paradigmenwechsel der Antike einen temporalen Aspekt oder chronischen Faktor einschließt und dass nämlich die Kapitalisierung des kommerziellen Systems, die Inhalt jener Neuerung und Veränderung ist, einen höchst dynamischen Prozess, eine nicht enden wollende historische Abfolge von objektiven Umwälzungen, von Revisionen und Adaptionen der Wirklichkeit im Sinne ihrer heteronomen Ausrichtung auf das eine große Ziel der als ebenso illusionäre wie idealische Projektion maßgebenden Kapitalakkumulation darstellt – diese Tatsache bringt es mit sich, dass die neuzeitliche Ästhetik ihrerseits einen zutiefst prozessualen Charakter annimmt und, eben weil sie dem in der Kapitalbewegung implizierten materialen Entwirklichungs- und realen Entwertungsprozess entgegenzutreten und Einhalt zu gebieten beansprucht, gezwungen ist, die prozessbedingten Veränderungen und Verflüchtigungen als in das Bild von der Wirklichkeit, das sie dagegen beschwört und festhält, zu integrierende permanent nachzuvollziehen beziehungsweise jene Veränderungen und Verflüchtigungen, soweit sie sie abzusehen vermag, als durch das Bild von der Wirklichkeit, das sie dagegen entwirft und vorschreibt, zu repräsentierende je schon vorwegzunehmen.
Die normative beziehungsweise regulative Funktion, die auch die neuzeitliche Ästhetik – wenngleich im Unterschied zur antiken nicht sowohl auf die Bestimmtheit des Bewusstseins oder Konstitution des Subjekts als vielmehr auf die Beschaffenheit des Seins oder Stiftung der Objektivität selbst bezogen – erfüllt, impliziert demnach von vornherein ein chronisches Moment oder eine historische Dimension, geht mit anderen Worten Hand in Hand mit der Notwendigkeit, der Norm, die sie setzt, gegen den ökonomischen Prozess, der sie immer neu außer Kraft zu setzen tendiert, Dauer und Bestand zu verleihen beziehungsweise die Regel, die sie vorschreibt, so zu entwerfen, dass sie den ständigen kapitalprozessualen Umwälzungen, die sie gegenstandslos zu machen drohen, standhält, besser gesagt, ihnen durch ihre virtuelle Vorwegnahme die aktuelle Zerstörungskraft zu verschlagen taugt.
Das Normative der neuzeitlichen Ästhetik weist mit anderen Worten automatisch die Verlaufsform des Konservativen auf, oder das Regulative besitzt zwangsläufig einen die weitere Entwicklung zu antizipieren bemühten Präventionscharakter. Als normativ in der Detaillierung eines konservativen Tuns erscheint also die neuzeitliche Ästhetik in dem Sinne, dass sie die Wahrnehmungsnorm, der sie das empirisch Gegebene unterwirft, gleich auch bemüht ist gegen die Anfechtungen zu behaupten, denen umgekehrt das Gegebene, seiner kursorischen Natur gemäß, die Norm aussetzt. Und als regulativ in der Spezifizierung eines präventiven Beginnens erweist sie sich in der Bedeutung, dass sie die Verhaltensregel, mit der sie dem praktischen Geschehen begegnet, ebenso wohl bestrebt ist, in ihrem Geltungsanspruch auf die Wendungen und Umwälzungen auszudehnen, durch die umgekehrt das Geschehen, seiner systematischen Heteronomie entsprechend, die Regel zu widerlegen droht.
Allgemeiner Ausdruck dieser durch die Einführung eines zugleich chronischen und antizipatorischen Faktors in die ästhetische Betätigung und Betrachtung charakterisierten Entfaltung des bloß normativen beziehungsweise regulativen zu einem mehr noch konservativen beziehungsweise präventiven Tun und Beginnen in der neuzeitlichen Ästhetik ist der Wechsel von der Plastik zur Fläche, die Ablösung der Bildhauerei durch die Malerei in der Rolle der für die Darstellung und Vergegenwärtigung der gegenständlichen Welt maßgebenden Kunstform.
Für die bloß mit der unmittelbaren Normierung der Objektwahrnehmung und Regulierung der Verhaltensweisen betraute antike Ästhetik ist das plastische Bildwerk die angemessene Präsentationsform. Weil es nur oder hauptsächlich darum geht, das vom marktwirtschaftlichen System hinsichtlich der Allgemeingültigkeit der sinnlichen Wahrnehmungen und der Verbindlichkeit der persönlichen Verhaltensweisen im Stich gelassene beziehungsweise der Partikularisierung und Auflösung ausgelieferte Bewusstsein durch Rekurs auf die den Perspektiven und Bedürfnissen der Handelsstadt angepassten Archetypen und Paradigmata der agrargesellschaftlichen Tradition konsensuell zu reaffirmieren und kommunal zu orientieren, genügt zur Beschwörung und Darstellung jener in Modelle der städtischen Wirklichkeit und Muster des städtischen Lebens umgerüsteten Archetypen und Paradigmata das plastische Bildwerk mit seiner ebenso idealen wie präsenten, ebenso abstrakten wie objektiven, ebenso sehr auf Grundstrukturen beschränkten, sprich, im Umriss gefassten, wie in dingliche Gestalt gebrachten, sprich, in Stein gehauenen beziehungsweise in Erz gegossenen Erscheinung. So gewiss es nur darum geht, dem Bewusstsein die verloren gegangenen allgemeinen Anschauungsformen oder Schablonen und verbindlichen Verhaltensweisen oder Schemata für die Erkenntnis und die Behandlung einer durch den Markt zwar systematisch-praktisch vereinnahmten, ihrer empirisch-technischen Beschaffenheit nach aber weitgehend unverändert gelassenen Wirklichkeit wiederzugeben, so gewiss ist die Plastik als die in Materie gegossene einfache Kategorie, die Ding gewordene Grundregel die zugleich sinnenfällig-ideale und handgreiflich-fassliche Präsentationsform.
In der Neuzeit hingegen ist ja das ästhetische Anliegen dies, die Wirklichkeit gegen die Heteronomisierung beziehungsweise Verflüchtigung zu behaupten und zu sichern, die sie in dem Maße bedroht und heimsucht, wie ihre systematisch-praktische Vereinnahmung durch den Markt mehr noch in einer Veränderung und Instrumentalisierung ihrer empirisch-technischen Beschaffenheit resultiert, wie also ihre Kommerzialisierung, ihre formale Inanspruchnahme für wertbestimmte Austauschakte, in ihre Kapitalisierung, ihre materiale Verwendung für verwertungsorientierte Produktionsprozesse übergeht beziehungsweise umschlägt. Die neuzeitliche Ästhetik ist einer Wirklichkeit konfrontiert, die in der letzten Konsequenz ihrer Inanspruchnahme für die kommerzielle Wertakkumulation sich zur Dispositionsmasse eines sie als solche umgestaltenden und seiner heteronomen Zweckmäßigkeit anpassenden, will heißen, sie bis in ihre materialen Bestimmungen und ihre reale Beschaffenheit hinein instrumentalisierenden und kapitalgemäß rationalisierenden industriellen Verwertungsprozesses degradiert zeigt.
Angesichts einer solchen, dem Verwertungsdrang bis in ihre dinglichen Gebrauchseigenschaften und sinnlichen Befriedigungsmomente hinein ausgelieferten Wirklichkeit kann sie sich schlechterdings nicht mehr darauf kaprizieren, dem individuellen Bewusstsein einen neuen, konsensuelle Allgemeingültigkeit und kommunale Verbindlichkeit gewährleistenden Realitätssinn einzugeben, sondern sie muss vielmehr darauf aus sein, dem kollektiven Bewusstsein gegen die von der Wirklichkeit selbst betriebene Unterminierung und Außerkraftsetzung ihrer traditionellen Wahrnehmungsformen und Organisationsweisen diese als die nach wie vor allgemeingültigen und verbindlichen zu vermitteln und vor Augen zu stellen, quasi also das kraft der kapitalen Heteronomisierung der Wirklichkeit von Entwirklichung und Entwertung bedrohte Bild von ihr aus ihr heraus beziehungsweise in sie hinein zu lesen und als noch immer ihr gemäßes, noch immer realistisches zu nutzen, um ihrer galoppierenden Schwindsucht und fortschreitenden Zweckentfremdung entgegenzuwirken und sie als eine nach wie vor sichselbstgleiche und nämlich der menschlichen Bedürfnisbefriedigung und Lebensgestaltung zugewandte und dienliche, statt von der heteronomen sächlichen Rationalität des kapitalen Verwertungsdrangs erfasste und durchdrungene zu reaffirmieren und unter Beweis zu stellen.
Kurz gesagt, kann angesichts dieser Verlagerung des Problems vom Subjekt, das einen kritischen Moment erlebt, in eine Objektivität, die einen chronischen Prozess durchläuft, das Programm der neuzeitlichen Ästhetik nicht mehr bloß eine epistemische Normierung des Bewusstseins sein, sondern muss mehr noch die ideologische Konservierung der Wirklichkeit selbst zum Ziel haben.
Und um dieses Ziel zu erreichen, ist nun das plastische Bildwerk mit seiner, aller Präsenz und Handgreiflichkeit, aller dinghaften Gestalt zum Trotz, wesentlich idealisch-abstrakten, auf den charakteristischen Umriss beschränkten Repräsentationstechnik das schwerlich geeignete Medium. Eher bietet sich dafür das malerische Kunstwerk mit seiner ebenso realistischen wie fiktiven, ebenso konkreten wie imaginativen, ebenso sehr auf materiale Qualitäten versessenen, sprich, ins Detail sinnenfälligen, wie bloß auf die Leinwand gezauberten, sprich, zeichengebundenen Darstellungsweise. Mit ihrem Bemühen, möglichst alles an der Wirklichkeit, sie in allen ihren Einzelheiten, wenn auch nur figurativ, nicht objektiv, nur auf die Fläche projiziert, nicht räumlich realisiert, wiederzugeben und festzuhalten, kommt die Malerei dem prozessbezogen normativen, sprich, konservativen Anliegen der neuzeitlichen Ästhetik entschieden entgegen. Mit ihrem die Dinge nicht essentiell reproduzierenden, abstrakt verdoppelnden, sondern phänomenal repräsentierenden, konkret abbildenden Verfahren schafft sie Werke, die in dem Maße geeignet sind, der ebenso alterativen wie abstraktiven Vereinnahmung der Welt durch den kapitalen Verwertungsprozess zu trotzen, wie sie die Wirklichkeit in aller Lebendigkeit, wenn auch nicht Leibhaftigkeit, und in aller Detailliertheit, wenn auch nicht Fleischesfülle vor Augen stellen und dauerhaft anschaubar machen. Durch die Einführung der Raumtiefe und die dadurch ermöglichte Einbettung der Gegenwart in einen absehbaren zeitlichen Rahmen erfüllt die ästhetische Darstellung ihre präventive Funktion, in deren Gewahrsam sie sich als konservatives, durch Detailtreue und Realismus dem Dasein Bestand und Beständigkeit vindizierendes Genrebild entfalten kann. Ungeachtet der relativen dynamischen und thematischen Kontinuität, die diese genrebildliche Kunst zu den Verbildlichungen der christlichen Tradition wahrt, bleibt doch als wesentlicher Unterschied zwischen der heiligenbildlichen Sanktionierung der Wirklichkeit und ihrer genrebildlichen Konservierung der Wechsel vom präskriptiven Dogmatismus zu einem deskriptiven Empirismus. Letzterer steht zwar im Dienste des Verwertungsprinzips, kehrt aber erst einmal den schönen Schein einer entfesselten, von perzeptionellen und habituellen Restriktionen befreiten Erfahrung hervor.
Als entscheidender und ihr Avancement zur ästhetischen Leitdisziplin besiegelnder Vorzug der Malkunst kommt aber noch hinzu, dass ihr eben durch ihre Beschränkung auf die Zweidimensionalität der Fläche eine dritte Dimension zur Verfügung steht, die sich zur Erfüllung der der neuzeitlichen Ästhetik neben ihrer konservativen Tätigkeit zufallenden zweiten Aufgabe der Prävention nutzen lässt. Das plastische Bildwerk muss, um in die Existenz zu treten, alle drei Raumdimensionen in Anspruch nehmen und gewinnt eben dadurch seine bei aller idealischen Abstraktheit und umrisshaften Schematik eigentümliche Präsenz und Handgreiflichkeit. Dem malerischen Kunstwerk hingegen genügen, weil es die Wirklichkeit, so realistisch und detailliert es sie abbildet, doch aber nur in repräsentativer Form oder zeichenhaft, als von ihr abgenommene Vorstellung oder Fiktion wiedergibt, zwei Raumdimensionen, und deshalb steht ihm die dritte Dimension zur Disposition, um dem für die neuzeitliche Ästhetik konstitutiven Bedürfnis nach einer die konservative Bekräftigung dessen, was ist, flankierenden präventiven Beschwörung dessen, was kommt, Rechnung zu tragen und in die Topik Chronologie, in die räumliche Szene einen zeitlichen Prospekt hineinzubringen.
Zwar stellt sich, formal gesehen, die Ende des Mittelalters und zu Beginn der Renaissance, die der Neuzeit Bahn bricht, in die Malerei Einzug haltende Perspektive, das heißt, die Ergänzung der beiden Flächendimensionen der Höhe und Breite durch die dritte für die Raumwahrnehmung erforderliche Dimension, die Tiefe, einfach nur als eine durch die Sichtachsen des Auges bestimmte und auf die Ebene der Leinwand übertragene Projektion der Raumwirklichkeit, eine der flächenförmigen Fiktion vindizierte Illusion von Körperlichkeit dar. Inhaltlich betrachtet, ist indes dieser in die Fläche hineinprojizierte Anschein von Tiefe mehr als nur Illusionsmalerei, mehr als nur Perfektionierung der malerischen Fiktion von Räumlichkeit, weil er nämlich eine Aufspaltung des Bildes in nah und fern, in Vorder- und Hintergrund, in Szene und Kulisse bewirkt, eine aus dem perspektivischen Fluchtpunkt heraus lancierte dimensionale Gliederung des Bildes ermöglicht, die, weil sie sich als Erstreckung oder Entfernung ausdrückt, nolens volens einen Zeitfaktor ins Spiel bringt und den Raum als Zeitraum, als eine Sphäre darstellt, in der die szenische Nähe oder vordergründige Gegenwart bezogen ist auf und eingebettet in ein hintergründiges Milieu, das die sich als Bezugsrahmen oder Lebenswelt suggerierende weitere Umgebung der gegenwärtigen Szene, ihre als Entfaltungsraum oder Zukunftsprospekt erscheinende fernere Aussicht beschwört.
Was hier und jetzt ist, zeigt sich kraft der zentralperspektivischen Orientierung des Bildes verknüpft mit einem Ambiente, von dem es ebenso sehr, spatial gesehen, involviert wie, temporal genommen, transzendiert wird und das, sollte das Hier und Jetzt in Bewegung geraten und sich fortentwickeln, all seiner Bewegung vorab den Rahmen steckt, jeglicher Weiterentwicklung je schon die Richtung weist beziehungsweise einen festen Anhalt bietet. Welche Entwicklung die gegenwärtige Szene auch immer nimmt, welche Richtung sie auch immer einschlagen mag, durch den perspektivisch beschworenen und als zugleich weitere Umgebung und fernere Aussicht firmierenden Hintergrund scheint diese Richtung in den Grundzügen definiert, diese Entwicklung im Wesentlichen vorprogrammiert. Der Hintergrund, den die Perspektive eröffnet, stellt eine Sphäre dar, in die alles, wozu die Szene sich entfaltet, gebannt bleibt, präsentiert ein Medium, nach dessen Maßgabe beziehungsweise unter dessen Kautel alles, was aus der Gegenwart wird, allein Wirklichkeit gewinnt.
Dies also ist die präventive Macht, die die in Form der Perspektive inhaltlich beschworene hintergründige Kulisse über die vordergründige Szene, das Milieu über die Gegenwart, ausübt, dass letztere, weit entfernt davon, schierer Augenblick zu sein und deshalb, wie aus nichts herzukommen, so auf alles gefasst sein zu müssen, einem gänzlich ungewissen Schicksal, jeder Art von Widerfahrnis ausgeliefert zu sein, vielmehr je schon raumzeitlich determiniert, umweltlich aufgehoben, milieugebunden ist und deshalb in ihrer weiteren Entwicklung und ferneren Aussicht vor unliebsamen Überraschungen beziehungsweise Kontinuität zerstörenden Neuerungen geschützt und vor unverhofften Wechselfällen beziehungsweise Identität bedrohenden Veränderungen bewahrt scheint.
Und es ist im Gewahrsam dieser effektiven Prävention, dieser durch die Einbettung der szenischen Gegenwart in die raumzeitlich umfassende Hintergründigkeit und zeiträumlich auslegbare Tiefe des Bildes ermöglichten und als ebenso sehr aktive Vorkehrung wie kontemplative Vorsehung erscheinenden definitiven Bestimmtheit dessen, was aus der Gegenwart werden, beziehungsweise relativen Beschränktheit dessen, was die Zukunft bringen kann – es ist im Gewahrsam dieser per Hintergrund vollbrachten Beschreibung des der Gegenwart gegebenen Entwicklungspotenzials beziehungsweise ins Haus stehenden Zukunftsprospekts, dass nun die neuzeitliche Ästhetik sich mit der nötigen Unbekümmertheit und Konzentration ihrem zweiten großen Anliegen zuzuwenden und nämlich dem ihr aufgetragenen konservativen oder, besser gesagt, konservatorischen Geschäft zu widmen vermag. Es ist mit anderen Worten vor dem Hintergrund und im Gewahrsam jener Kontinuität verheißenden perspektivischen Einbettung und Identität verleihenden Milieugebundenheit, dass die Ästhetik sich daran machen kann, die szenische Gegenwart ebenso akribisch wie liebevoll auszumalen, sie ebenso detailgetreu wie realistisch wiederzugeben, um sie auf diese Weise als solche zu bekräftigen und zu bewahren, sie als die gegebene Gegenwart und bestehende Wirklichkeit nicht nur zu normieren, den Zeitgenossen als für ihre Wahrnehmung und ihr Verhalten verbindlichen Gegenstand der Erfahrung und Prospekt des Handelns vorzuführen, sondern sie mehr noch und vor allem gegen die ihr durch die Dynamik des kapitalistischen Verwertungsprozesses innervierte Tendenz zur abstraktiven Funktionalisierung und transformativen Heteronomisierung zu behaupten und sicherzustellen.
Frucht dieses die Wirklichkeit vor Entwirklichung zu schützen und das Geltende vor Entwertung zu bewahren bestimmten Bemühens der neuzeitlichen Ästhetik, ihres mittels Detailtreue und Realismus wirksamen konservativen Beginnens ist die zur Haupt- und Staatsaktion der Malkunst insgesamt avancierende Gattung des Genrebilds, die als Sitten- oder Volksmalerei firmierende Wiedergabe und Abbildung des gesellschaftlichen Alltags, der säkularen Kultur und profanen Praxis verschiedener sozialer Schichten und Gruppen. Die Genremalerei, die die neuzeitliche Ästhetik ausbildet und kultiviert und in der sie ihre authentische Bestimmung findet, tritt an die Stelle der religiösen Kunst der mittelalterlichen Tradition, die um die biblische Geschichte im Allgemeinen und das Erdenleben Christi und seiner Nachfolger, der in seinen Fußstapfen wandelnden Heiligen, im Besonderen kreist.
Dabei vollzieht sich diese Ablösung der religiösen Thematik durch säkulare Motive, diese Ersetzung der auf die Wiedergabe der Heilsgeschichte und ihrer sakralen Ereignisse konzentrierten durch eine auf die Darstellung des alltäglichen Lebens und seines profanen Geschehens gerichtete Malerei, keineswegs ad hoc und in einem entsprechend radikalen Bruch mit der Tradition. Vielmehr handelt es sich dabei um einen zwar deutlich als solcher wahrnehmbaren, aber doch über einen längeren Zeitraum sich erstreckenden und nach Maßgabe der ihn im traditionellen Kontext selbst vorbereitenden Schritte relativ allmählichen beziehungsweise fließenden Übergang.
Die Möglichkeit für dieses Moment von evolutionärer Kontinuität und motivationaler Identität zwischen heilsgeschichtlicher Wiedergabe und genrebildlicher Darstellung liegt in dem oben erwähnten Unterschied der Archetypen und Paradigmata der christlichen Tradition zu denen der antiken Religion beschlossen: Während die letzteren einer spezifisch anderen politisch-ökonomischen Konstitution und Sozialstruktur, nämlich der territorialherrschaftlich-agrarwirtschaftlichen Gesellschaftsformation, verhaftet sind und deshalb, um von der neuen, handelsstädtisch-marktwirtschaftlichen Gemeinschaft ästhetisch nutzbar gemacht werden zu können, einer radikalen Umfunktionierung und Anpassung an die veränderten Verhältnisse bedürfen, sind die ersteren frei von solch politisch-ökonomischer Bestimmtheit und sozialformativer Voreingenommenheit und beanspruchen als dem Erdenwandel des Herrn und seiner Nachfolger entlehnte maßgebende Ansichten und prägende Ereignisse ab ovo ihrer Einsetzung die Universalität von für alle Gesellschaftstypen und für jedes Säkulum verbindlichen Wahrnehmungsformen und Verhaltensweisen. Als gratia dei oder um Christi willen der eigentlich absolut negativen, unbedingt weltflüchtigen heilsperspektivischen Motion entnommene und auf das irdische Leben zum Zwecke seiner Rechtfertigung und Sanktionierung angewandt, beanspruchen jene der vita sancta abgeschauten archetypischen Objektvorstellungen und paradigmatischen Umgangsformen von Anfang der christlichen Tradition an für das marktwirtschaftlich-kommunale Leben nicht weniger prägende Bedeutung und essentielle Geltung als für das agrarwirtschaftlich-feudale Dasein.
Um freilich diese prägende Bedeutung und essentielle Geltung für alle Bereiche und alle Zeiten der irdischen Existenz nicht nur gewinnen, sondern auch behalten zu können, um also dem topischen Wechsel und chronischen Wandel, dem die irdische Existenz unterliegt, gewachsen zu sein und standhalten zu können, müssen jene Objektvorstellungen und Umgangsformen flexibel und integrativ genug sein, um neue Phänomene und veränderte Verhältnisse in der Gesellschaft aufzunehmen und zu verkraften, müssen sie bei aller Prägekraft und Bestimmungsmacht, mit der sie sich dem gesellschaftlichen Leben oktroyieren und mit der sie es regulieren, doch zugleich ihrerseits hinlänglich modifizierbar und anpassungsfähig sein, um sich im historischen Wandel und Prozess als kategoriale Grundformen der Wahrnehmung und rituelle Bestimmungsweisen für das Verhalten jeweils regenerieren und immer wieder behaupten zu können.
So gesehen, sind die als Bestimmungsgründe und Verhaltensprinzipien für das irdische Leben geltend gemachten Archetypen und Paradigmata der christlichen Tradition anders als die der antiken Religion auch immer schon eingestandenermaßen – und nämlich sanktioniert durch eine apostolisch-theologische beziehungsweise kirchlich-konziliare Lehr- und Auslegungspraxis – Kompromissgebilde, sind sie immer schon eine Kreuzung aus dogmatisch-systematischen, sprich, gottgegebenen Grundsätzen und faktisch-historischen, sprich, zeitgeschichtlichen Einflüssen, sind sie nicht wie die Kategorien und Rituale der antiken Religion mythologisch-kultische, einer Urwelt entsprungene Schöpfungen, sondern empirisch-praktische, vom Weltlauf durchdrungene Setzungen. Und so gesehen, bedeutet nun auch die Ästhetisierung jener Archetypen und Paradigmata, ihre Inanspruchnahme und Verwendung in säkularer Absicht und für profane Zwecke, nicht wie in der Antike einen radikalen Bruch mit der religiösen Vergangenheit und erfordert keine aufwendige Revisionsanstrengung und Umrüstungsveranstaltung, sondern bleibt durchaus in einer ebenso sehr thematischen wie dynamischen Kontinuität mit jener religiösen Vergangenheit, kann an eine Tradition der Kompromissbildungen zwischen klerikal-sakraler Vorschrift und Geltung und säkular-profanem Anspruch und Einfluss anknüpfen, die bereits für die ganze christliche Tradition konstitutiv ist.
Das Moment von gleichermaßen dynamischer und thematischer Kontinuität zwischen dem religiösen Einsatz der Archetypen und Paradigmata und ihrer ästhetischen Verwendung und der dadurch ermöglichte eher allmähliche und fließende als abrupte und sprunghafte Übergang von ersterem zu letzterer ändern natürlich nichts an dem Funktionswandel, den die Archetypen und Paradigmata hierbei durchlaufen, und ihrer entsprechend veränderten Wirkungsweise. Schließlich dienen die religiösen, dem Leben Jesu und seiner Kirche entnommenen, aus der Heilsgeschichte stammenden Vorbilder der Wahrnehmung und Verhaltensbeispiele im Wesentlichen dazu, das irdische Dasein zu legitimieren und zu sanktionieren, das diesseitige, weltliche Leben des Menschen so zu prägen und darzustellen, seine Bedeutung so zu dekretieren, dass es mit der jenseitigen, weltflüchtigen Bestimmung des Menschen halbwegs im Einklang bleibt, wohingegen die ästhetischen, dem gegenwärtigen Dasein und wirklichen Leben selbst abgeschauten, sprich, dem gesellschaftlichen Alltag entnommenen typischen Geschehnisse und beispielhaften Situationen in der Hauptsache den Zweck verfolgen, eben das Dasein und Leben, dem sie entnommen sind, gegen die ihm von seiner ökonomischen Entwicklung vindizierte Abstraktheit und Flüchtigkeit zu reaffirmieren und zu konservieren, eben die Wirklichkeit, von der sie abgezogen sind, gegen die ihr kraft Kapitalisierung innervierte Tendenz zur Heteronomisierung und Veränderung sichselbstgleich abzubilden und als die identische festzuschreiben, sie so zu reflektieren, dass sie dem menschlichen Anspruch auf Bestand und Beständigkeit Genüge tut.
Der wichtige und sowohl die Funktion als auch die Wirkungsweise betreffende Unterschied ist also der, dass die religiösen Archetypen und Paradigmata im Zuge ihrer ästhetischen Verwandlung und Verwendung aufhören, sakral sanktionierende Vorbilder für die Wahrnehmung der Wirklichkeit und das Verhalten in ihr zu sein, und sich vielmehr der Wahrnehmung und dem Verhalten als die Wirklichkeit ideal repräsentierende Abbilder darbieten, dass sie mit anderen Worten nicht mehr der Aufgabe dienen, der Wirklichkeit systematisch vorausgesetzte und sie initiativ prägende und legitimierende kategoriale Matrizen und rituelle Schemata zu etablieren, sondern die Funktion übernehmen, durch die Wirklichkeit selbst empirisch gesetzte und sie reflexiv determinierende und identifizierende reale Modelle und praktische Muster zu inszenieren.
Aber so schwer im Blick gleichermaßen auf die Funktion und die Wirkungsweise der Wahrnehmungsmodelle und Verhaltensmuster der Unterschied zwischen religiöser Vorgabe und ästhetischer Wiedergabe beziehungsweise zwischen sanktionierender Prägung und konservierender Identifizierung, der Unterschied mit anderen Worten zwischen Heiligen- und Genrebild, zwischen Moralität und Sittenmalerei, ins Gewicht fällt, dank der erwähnten Tatsache, dass in der christlichen Tradition die der Negativität und Weltflüchtigkeit der Religion gratia dei abgewonnenen weltlichen Wahrnehmungskategorien und gesellschaftlichen Verhaltensweisen immer schon Kompromisscharakter aufweisen und nämlich der himmlischen Bestimmung abgetrotzte Kenntnisnahmen und Rechtfertigungen des irdischen Daseins sind und dass also das Sanktionieren und Dekretieren hier von Anfang an offen und zugänglich bleibt für die säkulare Wirklichkeit, die es zu sanktionieren dient, beziehungsweise beeinflusst wird und gesättigt ist von der profanen Empirie, über die es sein Urteil fällt, die es per decretum richtet – dank dieser Tatsache verläuft der Fortgang von der religiösen Kunst zur Kunst sans phrase, zur Ästhetik, vergleichsweise allmählich und kontinuierlich und findet zwischen beiden kein so radikaler Bruch und fundamentaler Paradigmenwechsel statt wie in der Kunst der klassischen Antike, die nichts Geringeres vollbringen muss als eine vollständige Umfunktionierung der alten Götter und restlose Umrüstung ihrer traditionellen Kulte und deren Radikalität und Fundamentalanspruch eben daraus erhellt, dass sie, um die von ihr der handelsstädtischen Gemeinschaft zur Verfügung gestellten Wahrnehmungsmuster und Verhaltensmodelle der alten Religion und ihren Ritualen entlehnen und abgewinnen zu können, ohne sich dadurch dem Verdacht eines sakrilegischen Übergriffs und einer nefariösen Zweckentfremdung auszusetzen, die alte Religion und ihre Rituale regelrecht aufheben und hinter sich verschwinden lassen, sich selbst als Religion gerieren und ihre Kreationen als rituelle Veranstaltungen zelebrieren, sprich, in eigener Gestalt an die Stelle dessen, was sie ersetzt und vielmehr verdrängt, treten, kurz, Kunst als Religion, Kunstreligion, sein muss.
Deutlicher Beweis dafür, dass solch ein radikaler Bruch und Wechsel der von der heiligenbildlichen Sanktionierung der Wirklichkeit zu ihrer genrebildlichen Konservierung fortschreitenden neuzeitlichen Ästhetik erspart bleibt, ist dies, dass die der Religion integrierte Kunst, die zur Ausstattung der Kultstätten dienende, als Kirchenschmuck bestimmte Malerei und Plastik ebenso sehr wie die Kultstätten selbst mit ihrer eigenen Architektur in die Neuzeit hinein ihre Fortsetzung finden und als Pendant zur säkularen Kunst und Architektur der Profanbauten unangefochtene Geltung behaupten und dass sich beide Kunstfunktionen, die der Religion integrierte und die sich als säkulare selbständig etablierende, so wenig abstoßen oder gar ausschließen, dass sie im Gegenteil, einander vielfältig befruchtend und überschneidend, als epochale Parallelaktion dastehen.
Und ein nicht minder deutlicher Beweis für die relative Kontinuität und annähernde Bruchlosigkeit zwischen der heiligenbildlich-religiösen Kunst der mittelalterlichen Vergangenheit und der genrebildlich-säkularen Kunst der neuzeitlichen Gegenwart ist darin zu sehen, dass die letztere die erstere so wenig ausgrenzen und verdrängen muss, dass sie sie im Gegenteil aufgreifen und sich assimilieren kann, dass mit anderen Worten die Gegenwartskunst sich im neuen Genre der Historienmalerei eine ihr gemäße, aus ihrer Perspektive revidierte, durch ihre Interessenlage reflektierte Vergangenheit, eine Geschichte nach ihrem Bilde, eine Genese saeculi generis, zu kreieren und auszumalen vermag.
Dennoch bleibt es ein wesentlicher und keineswegs mit leichter Hand zu überspielender Unterschied, ein alles andere als im Handumdrehen zu vollziehender Paradigmenwechsel, wenn im einen Fall, bei der das Leben des Herrn und seiner Nachfolger repräsentierenden heiligenbildlich-religiösen Kunst, deren archetypische und paradigmatische Darstellungen der Wirklichkeit dazu dienen, die aktuelle Realität, die gegenwärtige gesellschaftliche Wirklichkeit so zu prägen, dass sie im Einklang mit der heilsgeschichtlichen Perspektive bleibt, und wenn die demgemäß als Gießformen der Wahrnehmung und Klappmechanismen des Verhaltens vorausgesetzten religiösen Archetypen und Paradigmata erst im Rahmen dieser ihrer vorweg prägenden und sanktionierenden Funktion historischer Erfahrung zugänglich und offen für Einflüsse der aktuellen Wirklichkeit sind, während im anderen Fall, bei der das Leben der Volksschichten und ihre Sitten reflektierenden genrebildlich-säkularen Kunst, deren um Realismus und Detailtreue bemühte Abbildungen von Anfang an den Zweck verfolgen, der aktuellen Wirklichkeit selbst eine Modellhaftigkeit und Mustergültigkeit abzugewinnen, die erlaubt, sie im Einklang mit sich zu behaupten und sie gegen die Abstraktion und Entfremdung der in ihr ausbrechenden und sich durchsetzenden Verwertungsperspektive sich verwahren zu lassen.
Denkbar ist dieser Wechsel vom präskriptiven Dogmatismus der religiösen zum deskriptiven Empirismus der säkularen Kunst überhaupt nur, wenn entweder die Macht der religiösen Archetypen und Paradigmata über das allgemeine Bewusstsein in aller Form gebrochen beziehungsweise suspendiert wird oder wenn umgekehrt die säkulare Wirklichkeit eine solche Präsenz und Virulenz gewinnt, dass sie die religiösen Archetypen und Paradigmata hinlänglich verdrängt und in den Hintergrund treten lässt, um Platz für jenen empiriologisch-induktiven beziehungsweise inventorisch-reflexiven Prozess zu schaffen, der den Objekten ihre für sie selber maßgebende Modellhaftigkeit, dem Verhalten seine für es selbst verbindliche Mustergültigkeit abzugewinnen erlaubt.
Da ersteres, wie die relative Kontinuität und Allmählichkeit des Übergangs von der religiösen zur säkularen Kunst deutlich macht, nicht statthat, kann nur letzteres der Fall sein. Und in der Tat ist es so, dass zu Beginn der Neuzeit, in der als Renaissance in die Geschichte im Allgemeinen und die Kunstgeschichte im Besonderen eingegangenen anfänglichen Ära, die irdische Wirklichkeit, das menschliche Dasein in genere und die natürlichen Umstände und gesellschaftlichen Verhältnisse in specie eine bis dahin unbekannte Präsenz und Lebendigkeit, eine noch nie dagewesene Vordringlichkeit und Attraktivität gewinnen, kurz, ein Interesse und eine Aufmerksamkeit erregen, die, ohne die tradierten Wahrnehmungskategorien und Verhaltensschemata direkt in Frage zu stellen oder gar explizit abzudanken, sie doch einfach dadurch aushebeln und um ihre Verbindlichkeit bringen, dass sie die Wahrnehmung von eben jener sich ihr plötzlich als Wunderwelt offenbarenden Wirklichkeit vollständig präokkupiert, das Verhalten in eben jenem aus natürlichen Umständen und gesellschaftlichen Verhältnissen faszinierend gewirkten empirischen Dasein rückhaltlos engagiert sein lassen.
Wie die Beschäftigungen und Errungenschaften der Renaissance auf wissenschaftlichem, technischem, wirtschaftlichem, geographischem, politischem, künstlerischem Gebiet und in vielen anderen Bereichen des Lebens deutlich machen, tritt hier die Außenwelt, die kosmische ebenso wie die irdische, die heimische ebenso wie die exotische, die kultürliche ebenso wie die natürliche, jäh in den Mittelpunkt des menschlichen Interesses und wird in ihrer alles Mögliche einschließenden Wirklichkeit, ihrer von Potenzialität strotzenden Aktualität, ihrer von Bedeutung überquellenden Präsenz zum raumgreifenden Gegenstand und zeitfüllenden Anliegen allen von schierer Neugier bis zur Wissbegierde, vom Aberglauben bis zur Hypothese, von Abenteuerlust bis zum Forschungsdrang, von der Projektemacherei bis zum Erfindungsgeist reichenden theoretischen Beginnens und praktischen Tuns.
Der Grund für diese jähe Promulgation und Aufwertung der Wirklichkeit ist eben das, was sie nach dem obigen Befund zu entwirklichen und zu entwerten droht: der sie zunehmend durchdringende und als ebenso sehr kursorisches Moment wie Treibstoff in den Dienst seiner spiraligen Zirkelbewegung stellende kapitalistische Verwertungsprozess. So paradox es auf den ersten Blick anmuten mag, dass eben das, was die materiale Wirklichkeit und Sinnenwelt von sich selbst zu abstrahieren und sich zu entfremden bestimmt ist, der sich verwertende Wert, die kapitale Akkumulation, sich zugleich als dasjenige erweist, was jene materiale Wirklichkeit und Sinnenwelt in ihrer ganzen Konkretheit zur Geltung bringt, sie in all ihren Eigenheiten, in aller ihrer Vielgestaltigkeit, ihrem sinnlichen Formenreichtum und ihrer materialen Fülle zum Vorschein kommen lässt – bei genauerer Betrachtung weicht die vermeintliche Paradoxie einer unschwer einsehbaren Logik.
Schließlich ist kraft der ab ovo untrennbaren Verknüpfung zwischen dem kommerziellen Zweck und der sozialen Funktion des Marktes die kapitalistische Akkumulation von Wert ja unauflöslich gebunden an die Hervorbringung von als Wertverkörperungen firmierenden materialen Gütern oder realen Befriedigungsmitteln; das heißt, die Wertschöpfung kann sich nur im Rahmen und per medium der Güterproduktion vollziehen und lässt sich auch nur in dem Maße steigern und beschleunigen, wie es gelingt, jene Güterproduktion auszubauen und zu forcieren, die als Wertverkörperungen firmierenden realen Befriedigungsmittel zu vermehren und zu vervielfältigen. Auch wenn diese produktive, durch menschliche Arbeit bewirkte Amassierung und Diversifizierung der zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse bestimmten Objektwelt, diese konkrete Erschließung und spezifische Entfaltung materialer Wirklichkeit aus der Perspektive der Betreiber des Marktes beziehungsweise der kapitalistischen Produktion nur ein Durch- und Übergangsmoment darstellt und also letztlich nur dem abstrakten Zweck der Wertvermehrung, der pauschal unabsehbaren Absicht des qua Kapital sich selbst verwertenden Wertes dient, ist und bleibt sie doch unabdingbare Voraussetzung der Erfüllung jenes abstrakten Zwecks, conditio sine qua non der Verfolgung jener unabsehbaren Absicht.
Soll das kapitalistisch forcierte Wertakkumulationswerk gelingen, soll die materiale Realität der gesellschaftlichen Reproduktion in die Bande der Idealität kapitaler Wertschöpfung geschlagen werden, so muss deshalb diese Realität erst einmal entfesselt, muss sie der Beschränktheit des herkömmlichen Umgangs mit ihr, der Borniertheit ihres gewohnten Gebrauchs entrissen und in ihrem ganzen Befriedigungspotenzial erschlossen, in den vielfältigen Bedeutungen, der Mannigfaltigkeit von Gebrauchseigenschaften, die sie für das menschliche Dasein und Bedürfnis annehmen kann, herausgearbeitet werden. Das aber heißt, sie muss aus den engen Schranken und geordneten Bahnen herausgeführt werden, in denen das traditionelle Leben und Brauchtum, der territoriale und kommunale Alltag der Feudalgesellschaft sie verhält und deren Enge und Routine die für die Wirklichkeit Geltung und Verbindlichkeit beanspruchenden Wahrnehmungsformen und Verhaltensweisen religiöser Herkunft und ritueller Prägung ebenso sehr repräsentieren wie reaffirmieren, ebenso sehr widerspiegeln wie vorschreiben.
Um in den Dienst des gleichermaßen abstrakten und pauschalen kapitalistischen Verwertungsstrebens treten zu können, muss die natürliche und gesellschaftliche Wirklichkeit frei von den Voreingenommenheiten des archetypisch-heilsgeschichtlichen Weltverständnisses ins Auge gefasst und unabhängig von den Verfahrenszwängen des paradigmatisch-christologischen Erdenwandels angegangen werden können, müssen Dasein und Umwelt als nicht mehr je schon moralisch stereotypisierte und kultisch reglementierte Umstände und Verhältnisse sichtbar und verfügbar werden. Um dem nolens volens durch sie sich vermittelnden Anspruch auf kapitale Verwertung genügen zu können, müssen die empirischen Dinge und praktischen Verhältnisse ebenso sinnenfällig wie unmittelbar, nämlich in ihrer sinnenfälligen Bezogenheit auf menschliche Bedürfnisse und deren vielfältige Befriedigung und in ihrer unmittelbaren Bedeutung für weltliche Zwecke und deren einfallsreiche Erfüllung, in Betracht und zum Tragen kommen.
In diesem Sinne öffnet die kapitalistische Verwertungsperspektive, ihrer Abstraktheit und Pauschalität zum Trotz, den Blick für die empirische Wirklichkeit und aktuelle Präsenz in all ihrer Konkretheit und Detailliertheit, in ihrem ganzen unverstellten Reichtum, ihrer materialen Fülle an interessanten Aspekten, brauchbaren Eigenschaften, nutzbaren Potenzialen. Ausdruck dieses konkret-materialen Freisetzungseffekts, in dem die Unterwerfung der natürlichen Empirie und gesellschaftlichen Wirklichkeit unter den abstrakt-kapitalen Verwertungszwang unmittelbar resultiert, ist die beispiellose Aufgeschlossenheit, die eingangs der kapitalistischen Entwicklung, nämlich in der sich in einem grandiosen Selbstmissverständnis als Renaissance, als Wiedererweckung der klassischen Antike, behauptenden Frühphase der Neuzeit, das Bewusstsein, jedenfalls in seinen gesellschaftlich, wissenschaftlich und künstlerisch avanciertesten Erscheinungsformen, an den Tag legt, sind mit anderen Worten die Freisinnigkeit der Betrachtungsweise, die Spontaneität des Erkenntnisdrangs, die Aufnahmefähigkeit der Wahrnehmung, die Gier nach Erfahrung und Lust am Erleben, wie sie ein Leonardo und Dürer, ein Shakespeare und Boccaccio, ein Bruno und Bacon verkörpern und wie sie sich in dieser Breite und Intensität weder vorher noch nachher jemals wiederfinden.
Die konservatorisch-präventive Genremalerei ist mit guten Gründen in ihrer Objekt- und Motivwahl auf das Milieu und den Lebensstil der Oberschicht fixiert. Wegen der ständig aufreißenden Kluft zwischen verwertungsprozessual fortschreitender Realität und der genrebildlich festgehaltenen und reaffirmierten Wirklichkeit ist die ästhetische Darstellung zwangsläufig verklärend und idealisierend, wobei es sich bei der Idealisierung um keine abstrahierend-verwesentlichende Enthistorisierung à la Platonismus, sondern um eine spezifisch neuzeitliche, konkretisierend-verdinglichende Naturalisierung handelt. Augenblick der Wahrheit der genrebildlichen Tradition ist deshalb das Stillleben.
Zu offenkundig freilich setzt der kapitale Verwertungszwang die materiale Wirklichkeit und empirische Mannigfaltigkeit nur frei, um sie sogleich seiner monomanen Zielsetzung zu unterwerfen und nämlich zum Transportmittel und Durchgangsmoment einer um nichts als um ihrer selbst willen betriebenen Kapitalakkumulation zu machen, zu überwältigend und unwiderleglich drängt sich dem Bewusstsein die Einsicht auf, dass der neue ökonomische Mechanismus die Wirklichkeit nur der Vermittlung und Präsentation durch die traditionellen Objektkategorien und Verhaltensschemata entreißt und sie in ihrer qualitativen Mannigfaltigkeit und prospektiven Vieldeutigkeit nur unmittelbar erkennbar und sinnenfällig erfahrbar werden lässt, um die entfesselte Mannigfaltigkeit über den Kamm seiner abstrakten und nur in puncto quantitativer Zunahme Bewegung und Leben simulierenden Sichselbstgleichheit zu scheren, die sich erschließende Vieldeutigkeit sogleich wieder auf den einen, immer gleichen vitiosen Sinn der Wertschöpfung um der Wertschöpfung willen zu vereidigen, als dass sich jener anfänglich gewahrte schöne Schein von materialer Fülle und realer Vielfalt lange behaupten könnte und nicht dem ernüchterten Bewusstsein der alle unmittelbare Fülle und konkrete Vielfalt auf dem hekatombischen Altar der abstraktiven Selbstvermittlung des Werts zu opfern bestimmten kapitalistischen Agenda weichen müsste.
In dem Maße aber, wie dieses ernüchterte Bewusstsein sich durchsetzt, macht bei den die Archetypen und Paradigmata der christlichen Tradition ersetzenden oder, besser gesagt, beerbenden Mustern und Modellen der neuzeitlichen Wahrnehmungsnormierung und Verhaltensregulierung, macht mit anderen Worten in der sich aus der religiösen Kunst entwickelnden und sich von ihr emanzipierenden säkularen Ästhetik die inventorische Haltung jener ersten Stunde der dauerhaften und, wie sich zeigt, bis zum heutigen Tage verbindlichen konservatorischen Einstellung Platz, tritt an die Stelle der durch die Empirie inspirierten die gegen die Empirie reservierte Betrachtung, an die Stelle des Bestrebens, die kraft kapitalistischer Perspektive entfesselte Wirklichkeit als solche in Erfahrung zu bringen, ihr den ihr eigenen Sinn und Verstand abzulauschen, das Bemühen, diese Wirklichkeit gegen den ihr in der kapitalistischen Perspektive gemachten ebenso ständigen wie kurzen Prozess zu verteidigen und ihr, aller abstraktiven Funktionalisierung und heteronomen Veränderung, der die kapitale Verwertung sie unterwirft, zum Trotz, ihre Bedeutung zu erhalten und ihren Bestand zu sichern.
Es bildet sich mit anderen Worten jene für die ersten beiden Jahrhunderte der Neuzeit typische Genrebildlichkeit und Sittenmalerei heraus, die Realismus und Detailtreue nicht mehr im Interesse der Exploration und Erfahrung der Vielfalt und Prospektivität der kultürlichen und natürlichen Welt übt, sondern nur mehr im Dienste der Reaffirmation und Erhaltung des gewohnten kulturellen Alltags in seinem gegebenen naturalen Milieu praktiziert, deren Modellbildnerei und Mustergültigkeit mithin nicht mehr darauf zielt, die Welt zu erschließen und in ihrem Potenzial zu aktualisieren, sondern nurmehr darauf abgestellt ist, die Welt stillzustellen und in ihrer Aktualität gegen alles darin verborgene Potenzial zu behaupten.
Dabei ist es aus vierfachem Grunde plausibel, dass jene konservatorische Genremalerei ihren thematischen Schwerpunkt und die hauptsächliche Quelle für ihre Motive im Leben und Alltag der sozialen Oberschicht im Allgemeinen und der Adelsgesellschaft im Besonderen findet. Damit eine Lebensform als lebenswert, eine Wirklichkeit als erhaltenswert erscheint, das heißt dem für die neuzeitliche Ästhetik maßgebenden Gesichtspunkt genügt, muss sie erstens hinlänglich Wohlstand und Sicherheit, Schutz und Geborgenheit, Genuss und Annehmlichkeit bieten und darf nicht derart ärmlich und karg sein, darf sich nicht derart in der bloßen Subsistenz, der Stillung der grundlegendsten Bedürfnisse erschöpfen, dass ein ständiger Wandel der Lebensverhältnisse, wie der kapitalistische Verwertungsprozess ihn betreibt, für sie gar keine große Bedeutung gewinnt, weil er ihr, der mangels Masse ebenso sehr wie Klasse minimalisierten Existenz, zwar keinen Gewinn und keine Verbesserung verspricht, aber eben auch keinen Verlust und keine Verschlechterung bringen kann.
Zweitens ist das Leben der adligen Oberschicht eine zwieschlächtige Existenzform, die in ihrer Wohlhäbigkeit und Bequemlichkeit ebenso sehr durch agrarisch-fronwirtschaftliche Privilegien und Traditionen wie durch städtisch-handwerkliche Errungenschaften und Neuerungen konstituiert wird und geprägt ist und eben dieses ihres zwittrigen Charakters wegen von dem primär und vornehmlich das städtische Leben und die stadtbürgerliche Kultur funktionalisierenden und heteronomisierenden kapitalistischen Verwertungsprozess in ihrem Sosein und Bestand ganz besonders betroffen und bedroht ist. Indem das städtische Leben sich unter dem Einfluss des kapitalistischen Verwertungsstrebens im Sinne seiner Instrumentalisierung für letzteres rasant verändert, entfernt es sich zunehmend von oder gerät gar in wachsenden Gegensatz zu dem von der Verwertungsperspektive noch vorläufig ausgeschlossenen oder nur geringfügig tangierten Leben auf dem Lande und bringt so aber die ebenso sehr diesem agrarisch-fronwirtschaftlichen Sein verhafteten wie auf das städtisch-marktwirtschaftliche Dasein angewiesene adlige Oberschicht immer stärker in die Bredouille, stürzt sie immer mehr in das Dilemma, dass sie ihre kombinierte Lebensweise als schizophrene Existenzform erfährt, die sie vor die Entscheidung stellt, entweder um den Preis des Verzichts auf ihre agrarisch-territorialherrschaftlichen Traditionen und Privilegien an den städtisch-zivilgesellschaftlichen Fortschritten und Errungenschaften teilzuhaben oder sich umgekehrt durch das Festhalten an ersteren von letzteren abzukoppeln. Die adlige Oberschicht erfährt also die ihrer traditionellen Existenzweise und ihren gewohnten Lebensumständen durch die kapitalistische Verwertungsabsicht widerfahrende fortlaufende Funktionalisierung und Heteronomisierung nicht nur wie das Stadtbürgertum als einen Prozess rastloser realer Veränderung, Umstellung und Neuorientierung, sondern mehr noch als ein Phänomen haltloser sozialer Verarmung, Entstellung und Deklassierung. Entsprechend groß ist das Interesse dieser Schicht, sich von der genrebildlichen Kunst die nach Möglichkeit realistisch und en detail ausgeführten Modelle und Muster liefern zu lassen, die ihre zwieschlächtige Existenzweise und ihr wegen dieser Zwieschlächtigkeit von innerer Zersetzung bedrohtes Lebensmilieu ihr als ein dennoch ebenso haltbares wie einheitliches Konstrukt, einen aller kapitalsystematischen Prozessualität zum Trotz dem schönen Schein nach ebenso sehr für die Ewigkeit gemachten wie aus einem Guss gefertigten modus vivendi vor Augen stellen.
Drittens bleibt in den ersten gut zwei Jahrhunderten der Neuzeit die adlige Oberschicht die sozial und kulturell tonangebende Schicht, deren gesellschaftliche Funktion sich in dem Maße, wie sie ihre politische Machtstellung einbüßt beziehungsweise an die absolutistische Herrschaft abgeben muss, auf eben dieses Tonangeben, dieses repräsentative Darstellen und Vorführen normativer Anschauungsformen und paradigmatischer Verhaltensweisen reduziert, weshalb es für eine Ästhetik, die sich auf das konservatorische Geschäft vereidigt findet, der gesellschaftlichen Wirklichkeit und dem historischen Werden Bestand und Beständigkeit zu vindizieren beziehungsweise zu attestieren, nahe liegt, an diese normativ-paradigmatische Tätigkeit der adligen Oberschicht anzuknüpfen, um sie als quasi Vorarbeit zu betrachten und für ihre eigene modellbildnerische Genremalerei, ihre eigene musterschaffende Wiedergabe der Wirklichkeit zu nutzen.
Zwar ist wegen des zuvor erwähnten Moments von Ungleichzeitigkeit in den Lebensverhältnissen der adligen Oberschicht, wegen des zwittrigen Charakters ihrer der Hauptrichtung der stadtbürgerlichen Entwicklung wenn nicht widerstreitenden, so jedenfalls doch chronisch unangemessenen Existenzform, der Anspruch jener Oberschicht auf die Repräsentation der Gesamtgesellschaft, auf eine normativ-paradigmatische Vorführung des Kollektivlebens eher eine Prätention, eine Vorspiegelung falscher oder zumindest wahrheitswidriger Tatsachen, aber angesichts der dem gesellschaftlichen Leben der Neuzeit insgesamt durch den kapitalistischen Verwertungsdrang innervierten ständigen Entwirklichungs- und Entwertungstendenz gilt dieses Moment von nichtrepräsentativer Wiedergabe ja auch für die Ästhetik selbst, trifft der Prätentionsvorwurf auch und durchaus deren genrebildlichen Modelle und ebenso viel Realismus wie Detailtreue suggerierenden Muster, zielt er mit anderen Worten ins Zentrum der realitätswidrig konservatorischen und perspektivisch apotropäischen ästhetischen Praxis, und so gesehen verwandelt sich der Einwand gegen die Vorzugsstellung, die das Leben und Treiben der adligen Oberschicht in der Motiv- und Objektwahl der neuzeitlichen Genremalerei genießt, geradezu in einen Rechtfertigungsgrund für die enge Verknüpfung zwischen künstlerischer Inszenierung und adligem Milieu.
Und viertens und nicht zuletzt ist natürlich ein weiterer Grund für das Schwergewicht, das die neuzeitliche Ästhetik der ersten gut zwei Jahrhunderte in ihrer Objekt- und Motivwahl auf das Milieu und den Lebensstil der adligen Oberschicht legt, ein weiterer Grund also für die vornehmliche Beschäftigung der Kunst jener Epoche mit der ebenso realistischen wie detailgenauen Wiedergabe des Erscheinungsbildes, des gesellschaftlichen Auftretens und des Alltags der wenn schon nicht mehr politisch herrschenden und effektiv die Macht übenden, so immerhin doch sozial tonangebenden und konsumtiv privilegierten Klasse, die Tatsache, dass dank ihres Wohlstands und ihres Konsumniveaus diese Klasse die Hauptgeldgeberin für künstlerische Produktionen ist, dass also so, wie im Mittelalter die Künstler für ihr Schaffen von der geistlichen und in geringerem Maße der weltlichen Herrschaft aus dem beiden Mächten verfügbaren Überfluss alimentiert und munifiziert werden, sie sich auch jetzt noch vornehmlich von der begüterten Oberschicht, die jene Mächte, wenn auch nicht politisch und moralisch, so jedenfalls doch ökonomisch und lebenspraktisch beerbt, für ihre Produktionen honoriert und finanziert finden.
Dass dies letztere – das Prinzip des ,,Wes Brot ich ess', des Lied ich sing" – der ausschlaggebende Grund für die ästhetische Objektwahl ist, die conditio sine qua non, ohne die die anderen Gründe gar nicht erst zum Tragen kämen, dass also Basis für die zentrale Rolle des Lebens der adligen Oberschicht in der – Szenenschilderungen und Landschaftsdarstellungen ebenso wie Porträtkunst umfassenden – Sittenmalerei der neuzeitlichen Ästhetik eher funktionell-ökonomische Zwänge als traditionell-hierarchische Rücksichten sind, beweist dabei schlagend die Tatsache, dass in den Regionen, in denen, wie etwa im flandrisch-niederländischen Raum, die städtisch fundierte kapitalistische Entwicklung besonders dynamisch, platzgreifend und gewinnbringend verläuft und die traditionelle Adelsschicht in den Schatten stellt und marginalisiert beziehungsweise der städtischen Kultur weitgehend integriert, als vornehmlicher Gegenstand des als genrebildliches Konservieren wohlverstandenen ästhetischen Musterns und Modellierens ohne weiteres der betuchte Bürger den begüterten Adligen ersetzen und an die Stelle des territorial fundierten höfischen Zeremoniells die kommunal zentrierte patrizische Kultur treten kann.
Aber egal welche Schicht im Zentrum der ästhetischen Aufmerksamkeit und der modellbildenden beziehungsweise musterschaffenden Malkunst steht, immer geht es dabei um die Konservierung des wegen der Annehmlichkeiten, die es gewährt, und wegen der Qualität und Kontinuität, die es dem Leben verleiht, erhaltenswerten Bestehenden und dessen präventive Verteidigung gegen einen die gesellschaftliche Realität zum Mittel seiner abstraktiven Zwecksetzung instrumentalisierenden und um dieses Zweckes willen ständig refutierenden und transformierenden kapitalen Verwertungsprozess. Und stets impliziert dieses konservatorisch-präventive Programm der neuzeitlichen Ästhetik zweierlei: eine Stillstellung der genrebildlich wiedergegebenen Realität und eine dadurch nolens volens aufreißende Kluft zwischen ihr und der im Gegensatz zu ihr fortschreitenden oder vielmehr von der Dynamik des politisch-ökonomischen Prozesses fortgerissenen gesellschaftlichen Empirie einerseits und einen mit dieser Stillstellung beziehungsweise der Kluft, die sie nolens volens aufreißt, einhergehenden und in Idealisierung oder Schönfärberei resultierenden Mangel an Sinn für das, was wirklich ist, andererseits.
Weil die genrebildlich konservierende Ästhetik, all ihren präventiven Anstrengungen zum Trotz, doch immer Spielball der treibenden gesellschaftlichen Kraft, des kapitalen Verwertungsprozesses, bleibt und in reaktiver Abhängigkeit von den fortlaufenden Veränderungen und Entwicklungen verharrt, denen dieser Prozess die Wirklichkeit unterwirft, weil sie also mit ihrer konservierenden Tätigkeit und ihrer präventiven Anstrengung nur immer auf das reagieren, nur immer dem Widerstand leisten und entgegenarbeiten kann, was der Prozess jeweils schon potenziell oder aktuell an seiner Zwecksetzung gemäßeren Alternativen und in seinem Sinne wirksameren Substituten hervortreibt, ist das, was sie für erhaltenswert erachtet und mit ebenso viel Realismus wie Detailtreue wiedergibt und festhält, im Augenblick solchen Festhaltens und Wiedergebens in Wahrheit immer schon durch das, was der Prozess an Neuem hervortreibt und an Wirklichem schafft, abgetan und überholt, ad acta gelegt und für obsolet erklärt.
Durch den fortschreitenden gesellschaftlichen Prozess objektiv abgetan und, all seiner empirisch anhaltenden Gegenwärtigkeit zum Trotz, einer chronischen Zäsur, einer vom Modus der Vergangenheit heimgesuchten Ungleichzeitigkeit überführt, ist aber das Festgehaltene und Wiedergegebene nolens volens Gegenstand und Inhalt eines als Erinnerung firmierenden Klärungs- und Identifizierungsvorganges, der das Wesentliche vom Unwesentlichen, das, was aufgehoben werden, von dem, was vergessen sein soll, scheidet, der mit anderen Worten das, was nicht mehr Wirklichkeit ist, was aufgehört hat, Gegenwart oder Präsens zu sein, als Gewesenes, als Vergangenheit oder Perfekt setzt und für die an seine Stelle getretene neue Wirklichkeit oder Gegenwart als deren gleichermaßen genetisches Moment und generisches Element, als zugleich ihren konstitutiven Faktor und ihr konstitutionelles Merkmal reklamiert.
Im Fall der neuzeitlichen Ästhetik und ihres aufs Stillstellen und Erhalten gerichteten genrebildlichen Wiedergabeprogramms geht es freilich nicht darum, das, was war und nicht mehr, oder jedenfalls nicht mehr wirklich, ist, in ein konstitutives Moment der Gegenwart beziehungsweise konstitutionelles Element der Wirklichkeit zu überführen und aufzuheben, sondern es ist im Gegenteil darum zu tun, dies von der fortschreitenden Gegenwart ad acta Gelegte und für unwirklich Erklärte gegen den Prozess, den die Gegenwart ihm macht, als ein eigenständiges Dasein, eine Wirklichkeit sui generis festzuhalten und zu reaffirmieren. Das heißt, die genrebildliche Wiedergabearbeit der neuzeitlichen Ästhetik zielt nicht auf die Integration, sondern auf die Konservierung des Wiedergegebenen, nicht auf seine reflexive Vermittlung durch, sondern auf seine präventive Verwahrung gegen das aktuell Gegebene, und eben deshalb ist das Erinnerungsverfahren, als das sich die genrebildliche Wiedergabe nach Maßgabe der Kluft, die sie zwischen dem ästhetisch Wiedergegebenen und dem empirisch Gegebenen nolens volens aufreißt, ebenso zwangsläufig darstellt, kein Klärungsverfahren, sondern eine Verklärungsaktion, kein Versuch, die von der Aktualität des Verwertungsprozesses überholte Wirklichkeit als von der Gegenwart aufgehobenes Perfekt zu identifizieren, sondern sie zu einem der Aktualisierung durch den gesellschaftlichen Prozess trotzenden Präsens sui generis, einer als solche perfektionierten Gegenwart zu idealisieren.
Und dabei ist aber diese von der neuzeitlichen Ästhetik betriebene Verklärung oder Idealisierung, weil sie sich auf eine Wirklichkeit bezieht, eine Welt zum Gegenstand hat, die, während sie sich durch den gesellschaftlichen Prozess systematisch ad acta gelegt und in den Modus der Vergangenheit versetzt zeigt, sich doch durchaus noch empirisch in Szene setzt und als wie immer ungleichzeitige Gegenwart ebenso effektiv wie demonstrativ behauptet, keine Idealisierung im klassischen, vom Platonismus geprägten Verstand einer abstraktiven Verknöcherung, einer die Sache selbst aus ihrer phänomenalen Materialisierung abziehenden und ausscheidenden Enthistorisierung, sondern im neuen und spezifisch neuzeitlichen Sinn einer konkretisierenden Verdinglichung, einer, wie man will, das factum brutum oder fait accompli von seiner prozessualen Realisierung abtrennenden und dissoziierenden Naturalisierung. Was die genrebildliche Ästhetik als idealisierte Wirklichkeit wiedergibt, was sie als die verklärte Gegenwart beschwört, ist nicht die à la Platonismus versteinerte Seele, sondern der à la Realismus erstarrte Leib, ist mit anderen Worten nicht der en gros skizzierte, verdichtete Geist des Buchstabens, sondern sind die en detail ausgeführten gelösten Glieder des Leichnams.
Eben deshalb ist es auch nur scheinbar ein Widerspruch, wenn der neuzeitlichen Ästhetik oben Realismus und Detailtreue attestiert wird. Weil es bei der Idealisierung und Verklärung, die sie betreibt, nicht um Stillstellung und Erhaltung der vom kapitalistischen Prozess als ungleichzeitig abgetanen Wirklichkeit im Verstande platonischer Verwesentlichung, sondern im Sinne phänomenologischer Verdinglichung geht, weil mit anderen Worten das, was die genrebildliche Kunst modellhaft und mustergültig zu reproduzieren sucht, kein zeitloses Perfekt, keine ewige Struktur, sondern ein unvergängliches Präsens, eine bleibende Empirie, kurz, kein Skelett, sondern eine Mumie ist, kann diese Idealisierung durchaus die Form ihres vermeintlich genauen Gegenteils annehmen und als Realismus erscheinen, kann die eigentlich abstraktive Verklärung sich in einer regelrechten coincidentia oppositorum als detailversessene Materialisierung darbieten.
Genau diese Koinzidenz von Idealisierung und Realismus, Verklärung und Akribie leistet das Stillleben, das deshalb auch als, wie man will, das Leitfossil oder die Krönung dieser ersten, ums Genrebild kreisenden Epoche der neuzeitlichen Ästhetik gelten kann. Das Stillleben oder, wie die weniger euphemistisch gesinnte französische Sprache es will, die nature morte ist stillgestelltes Leben, kaltgemachte Welt, der Bewegung des Lebens entrissene, aus dem historischen Prozess ausgeschiedene Wirklichkeit, aber doch nicht zugrunde gegangen und verschwunden, nicht verwest und aufgelöst, sondern als quasi lebendig festgehalten, als Niederschlag der Geschichte, als nackte Tatsache, eben als Natur perennierend – festgehalten und perennierend nicht allerdings in der Form eines resultativen Perfekts, sondern in der Gestalt eines suggestiven Präsens, nicht mithin im platonischen Modus der zum abstrakten Schema, zur ewigen Idee aufgehobenen und verwesentlichten Empirie, sondern im phänomenologischen Duktus eines zum konkreten Gespenst, zum unvergänglichen Corpus assemblierten und verdinglichten Materials.
Als die genrebildliche Tradition in ihrer konservatorischen Funktion krönende Disziplin ist das Stillleben Natur, eine gegen den historischen Prozess, der sie sich einverleiben und anverwandeln will, festgehaltene und als ebenso isolierte wie leibhaftige Unmittelbarkeit, als schiere Gegebenheit wiedergegebene Wirklichkeit. Und tote Natur ist diese als Stillleben erscheinende Wirklichkeit, weil sie als das aus dem historischen Kontext herausgesprengte und in diesem Sinne unmittelbar Gegebene nicht in der klassischen Form des zum zeitlosen Schema abstrahierten, zum ewigen Sein aufgehobenen Perfekts, der Idee, figuriert, sondern in der empirischen Gestalt eines zum unvergänglichen Dasein konkretisierten, zum bleibenden Phantom ausgebreiteten Präsens oder Phänomens sich darstellt, weil sie also nicht vergeht, um als Wesen zu perennieren, sondern stirbt, um als Revenant fortzudauern.
Das Moment von empirischer Präsenz und Konkretheit, von Realismus und Detailgenauigkeit, das die das Genrebild auf die Spitze treibende nature morte beweist, könnte auf den ersten Blick eine Ähnlichkeit beziehungsweise Kontinuität des Stilllebens mit den natur- und kulturkundlichen Abbildungen oder auch den technischen Entwürfen aus der Frühzeit der neuzeitlichen Ästhetik suggerieren, wie man sie etwa bei einem Leonardo oder Dürer antrifft. Der Schein freilich trügt. Jene ebenso detaillierten wie realistischen Darstellungen von Gegenständen aus dem Arsenal und Panoptikum der natürlichen Welt und des menschlichen Lebens sind, wie oben bereits bemerkt, der Entbindung der Empirie von den heilsgeschichtlichen Topoi und Vorbildern geschuldet, mit denen bis dahin der Erdenwandel des Herrn im Besonderen und das Leben der Heiligen im Allgemeinen die Objektwahrnehmung bestimmen und das soziale Verhalten prägen. Sie erforschen das Entwicklungspotenzial einer mangels Voreingenommenheit durch christliche Schemata und Paradigmata von sich aus und aus eigenen Stücken modellgebenden und musterbildenden Empirie und dienen noch nicht wie das Stillleben dem gegenteiligen Versuch, die Aktualität dieser Empirie gegen den sie immer wieder Lügen strafenden und der Schwindsucht überantwortenden kapitalistischen Verwertungsprozess festzuhalten und stillzustellen.
Ihr Ziel ist mit anderen Worten Realisierung und Entfaltung dessen, was sich auf den ersten Blick oder dem schönen Schein nach im Modus des Werdens zu präsentieren, als zukunftsträchtige Gleichzeitigkeit zu manifestieren verspricht, nicht Idealisierung und Verklärung dessen, was sich bei genauerem Hinsehen oder seiner traurigen Wahrheit nach durch das Werden der Gegenwart in den Modus der Vergangenheit versetzt, in die Abstraktion der Ungleichzeitigkeit getrieben findet und sich dagegen als ein reales Dasein sui generis zu verwahren, als ein dem Werden entrücktes und dadurch unvergänglich gewordenes, sprich, ebenso totes wie konkretes Präsens zu konservieren sucht.
Fußnoten
- ... Stelle6
- Siehe Reichtum und Religion, Viertes Buch: Die Macht des Kapitals, 1. Band: Der Weg zur Macht, Kap. 1, Papyrossa Verlag, Köln 2010.
- ... erleiden.7
- Zum Folgenden siehe Reichtum und Religion, Zweites Buch: textitDie Herrschaft des Wesens, 4. Band: Die Krise des Reichtums, Freiburg 2005.
- ... dargelegt.8
- Siehe Herrschaft, Wert, Markt – Zur Genese des kommerziellen Systems, Münster 2006.
- ... dargestellt9
- Siehe Herrschaft, Wert, Markt – Zur Genese des kommerziellen Systems, Münster 2006.