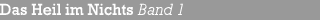2. Theokratie
Die schließliche Befreiung des Reichtums von der totenkultlichen Jenseitsverfallenheit ist Folge der Bildung stratifizierter Gesellschaften, die ihrerseits Resultat der wachsenden Reichtumsunterschiede zwischen armen, nomadischen und reichen, agrarischen Stämmen ist. In keiner genealogischen Abhängigkeit von den Totenkulten der eroberten Stammesregionen mehr befangen und konfrontiert mit einer Vielzahl solcher Kulte, kann der als neuer Statthalter sich etablierende nomadische Eroberer die plutonisch-chthonischen Herren der Kulte der Anonymität und Pluralität ätherisch-olympischer Götter überführen und damit sich selber von allem katabolischen Nachfolgedruck und Wiederholungszwang ihnen gegenüber emanzipieren.
Mitnichten hat also die Einsetzung eines Statthalters für den Verschiedenen die erhoffte Befreiung der Stammessubjekte vom Fluch der plutonischen Katabole und thesaurischen Abgründigkeit des Überflusses zur Folge gehabt. Nicht nur läßt schließlich der Statthalter den Reichtum perfekter, weil direkter als zuvor, eben die katabolische Bahn wieder beschreiben, von der er ihn doch gerade abhalten sollte, läßt am Ende der Stellvertreter den Überfluß effektiver, weil automatischer denn je, die abgründige Bewegung neu ausführen, an der er ihn gerade hindern sollte; darüber hinaus leistet der neue Modus dieser vom Statthalter aus eigenem Antrieb perfekter wieder aufgenommenen Verjenseitigung des Reichtums im Blick auf eine mögliche Anbindung des Jenseits ans Diesseits geradeso wenig wie jedes frühere Verfahren. Verantwortlich für das umfassende Debakel des im Statthalter Gestalt gewordenen Strebens nach einer Rezentrierung des Reichtums im Diesseits ist die Projektion auf den Verschiedenen und Identifikation mit dem Toten, zu der der Statthalter angesichts der eigenen Vergänglichkeit sich hinreißen läßt, ist mithin dies, daß er im Verschiedenen sein eigenes künftiges Selbst, im Toten seine eigene spätere Identität erkennt und in seiner gegenwärtigen Gestalt deshalb nur die Vorform dessen, was er selber erst wird, in seiner jetzigen Person bloß die Vorbereitung auf das, was er noch gar nicht eigentlich ist, gewahrt. Weil seine eigene jenseitige Perspektive den Stellvertreter im Toten, den er vertritt, nicht bloß den Grund zu der Annahme finden läßt, daß er auf Erden in Wahrheit gar nichts verloren hat, sondern mehr noch die feste Überzeugung gewinnen läßt, daß er in Wirklichkeit gar nicht von dieser Welt ist, kann er mit dem Reichtum, der ihm auf Erden zufällt, nicht anders verfahren als in der geschilderten, unmittelbar jenseitsbezogenen, unmittelbar auf die Erfordernisse seines künftigen unterweltlichen Seins gemünzten Weise. Damit er anders verfahren könnte und, mindestens für die Dauer seines innerweltlichen Lebens, imstande wäre, den Reichtum in der von den Stammessubjekten gewünschten Form in der Immanenz festzuhalten, müßte erst einmal die Basis für jene Projektion des Statthalters auf den Verschiedenen verschwinden und nämlich die alles entscheidende Tatsache entfallen, daß in vollständiger Parallelität und vielmehr Synonymität der Tote war, was der Stellvertreter ist, und ist, was dieser sein wird. Mit allen geschilderten Auswirkungen auf den Reichtum in einer nicht sowohl förmlichen imitatio dei als vielmehr wirklichen repetitio rei sich mit dem Toten identifizieren muß der Stellvertreter ja allein deshalb, weil der Tote haargenau das, was als Herrscher über den Überfluß der Stellvertreter an seiner Stelle darstellt, zu Lebzeiten in eigener Person einmal dargestellt hat, und weil eben darum auch umgekehrt das, was der Tote jetzt als Herr der Unterwelt ist, haargenau das ist, was der Stellvertreter in eigener Person später vorstellen wird. Um eine auf das Dasein im Diesseits gemünzte Selbständigkeit gewinnen und ein in der Immanenz verhaltenes Eigenleben führen zu können, müßte der Stellvertreter erst einmal diese ihn mit Haut und Haar zum jenseitigen Sein disponierende Ebenbildlichkeit mit dem Verschiedenen, diese ihn mit Leib und Seele zur transzendenten Existenz bestimmende Gleichsinnigkeit mit dem Toten loswerden. Wie aber könnte das geschehen, da ja mit jeder weiteren Statthaltergeneration, mit jeder ablebensbedingt neuen Person im Stellvertreteramt, die hypothekarische Last dieser Ebenbildlichkeit nur immer größer, die bindende Verpflichtung dieser Gleichsinnigkeit nur immer unentrinnbarer zu werden verspricht? Je mehr Statthalter schon aufeinander gefolgt sind, um so unwiderstehlicher wird der Nachfolgedruck, um so unabweislicher der Wiederholungszwang, zumal nun die Identifikation mit der im Toten zusammengefaßten Reihe oder verdichteten Folge von Vorläufern nicht mehr nur Konsequenz der abstrakten Tatsache ist, daß der Verschiedene dem Statthalter als Herr des Reichtums ins Jenseits vorangegangen, der Tote dem Stellvertreter als Überflußeigner in die Transzendenz vorausgeeilt ist, sondern mehr noch dem konkreten Umstand Rechnung trägt, daß er dabei auf die gleiche, fundamental jenseitsbezogene Art wie der Statthalter mit dem Reichtum umgegangen ist, in derselben, radikal transzendenzbestimmten Weise wie der Stellvertreter über den Überfluß verfügt hat. Woher sollte angesichts der zu dem einen Herrn der Unterwelt komprimierten langen Reihe von Toten, die zu Lebzeiten alle auf dieselbe Weise wie er, ihr Ebenbild und Nachfolger, den Reichtum unmittelbar in eine jenseitige Seinsbestimmung umgesetzt haben, der jeweils jüngste Statthalter die Kraft nehmen oder die Freiheit schöpfen, dem Reichtum eine eigene diesseitige Fasson zurückzugeben? Durch die Aussicht auf seinen eigenen Tod an einen Verschiedenen gebunden, der bis ins Detail der Überflußverwendung hinein ihn zur ebenbildlichen Nachfolge und gleichförmigen Wiederholung verhält, ist er augenscheinlich bar jeder Möglichkeit, von sich aus einen Dispens von der Verpflichtung zur Nachfolge zu erwirken und eine Befreiung vom Wiederholungszwang durchzusetzen.
Indes, wozu dem Stellvertreter aus eigenen Stücken die Möglichkeit fehlt, dazu erhält er nun überraschend aus äußerem Anlaß und aus anderen Umständen die Gelegenheit. Dieser äußere Anlaß ist das ebensosehr in der Logik der Überflußentwicklung gelegene wie die Grenzen der bisherigen Betrachtung sprengende Entstehen großer Reichtumsunterschiede zwischen den verschiedenen Stämmen und gravierender Abstufungen in der Menge ihres jeweiligen Überflusses. Und demgemäß sind die anderen Umstände Folge der politischen Rivalitäten und kriegerischen Auseinandersetzungen, die wegen dieser Unterschiede im Reichtum zwischen den Stämmen entbrennen, sowie der Umwälzung im Verhältnis der Stämme zueinander, der mehr oder minder gewaltsamen Umordnung oder vielmehr Neubestimmung ihrer wechselseitigen Beziehungen, in der jene Auseinandersetzungen resultieren. Je nach klimatischen Verhältnissen, Fruchtbarkeit des Bodens, Wasserreichtum, Vielzahl und Menge der Bodenschätze, Gelegenheit der sächlichen Produktionsbedingungen, Zahl der Arbeitskräfte und Stand der handwerklichen Fertigkeiten geht die Reichtumsbildung in den einzelnen geographisch verschiedenen Regionen unterschiedlich rasch vor sich mit dem Ergebnis, daß die Schere in Besitzstand und Vermögen der regional verschiedenen Stämme zunehmend weiter auseinanderklafft, das kulturelle Gefälle zwischen, geographisch gesehen, den Besiedlern der kargen Bergregionen und den Bewohnern der fetten Flußtäler zunehmend größer wird. Die Folge sind Überfälle und Raubzüge, die, anfangs vereinzelt und bei Gelegenheit, allmählich aber häufiger und habituell, die armen gegen die reichen Stämme unternehmen, Beutezüge, die in dem Maß, wie sie zur Gewohnheit und regelmäßigen Veranstaltung werden, zum wichtigen Faktor in der Reproduktionstätigkeit der armen Stämme und zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer Ökonomie avancieren. Das wiederum hat zur Konsequenz, daß die armen Stämme einen erheblichen Teil ihrer Arbeitsleistung und Produktivkraft an die Vorbereitung und erfolgreiche Durchführung jener Kriegszüge wenden, das heißt ein beträchtliches Maß ihrer Energie in die Ausbildung kriegerischer Tüchtigkeit und militärtechnischer Fertigkeiten stecken. Die reichen Stämme setzen dem keine entsprechenden militärischen Anstrengungen entgegen und beschränken ihre diesbezüglichen Bemühungen auf mehr oder minder effektive Abwehrmaßnahmen – zu Anfang, weil die Überfälle zu sporadisch sind und zu wenig Schaden anrichten, um den Aufbau eines an allen Punkten wirksamen Verteidigungssystems zu rechtfertigen, und später dann, als die Raubzüge gewohnheits- und regelmäßig stattfinden, weil die Produktivkraft der reichen Stämme inzwischen so groß ist, daß, zieht man eine Kosten/Nutzen-Bilanz, die Arbeit, die zur Erhaltung des bestehenden Reichtums aufgewendet und ins Kriegshandwerk gesteckt werden müßte, immer noch besser und nutzbringender angewandt ist, wenn sie statt dessen unter Inkaufnahme der regelmäßigen Reichtumsverluste in die produktiven Tätigkeiten gesteckt und zur Erzeugung neuen Reichtums verwendet wird.
Kommt es damit nun bereits zu einer stillschweigenden und de facto funktionierenden "Arbeitsteilung" zwischen agrarisch-städtischen, Reichtum produzierenden und nomadisch-kriegerischen, Reichtum appropriierenden Stämmen, so führt der hierbei den Strategien beider Seiten beschiedene relative Erfolg dazu, daß diese sich in der einmal eingeschlagenen Richtung immer weiter spezialisieren, bis irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem die Überführung der de facto herrschenden Funktionenteilung in eine von beiden Seiten akzeptierte und also auch de jure bestehende Einrichtung sich geradezu aufdrängt. Der langen Raubmärsche und beschwerlichen Beutezüge müde, beschließen die nomadisch-kriegerischen Stämme, das letzte Hindernis, das der vollen Realisierung ihrer parasitären Gemeinschaft mit den agrarisch-städtischen Stämmen noch im Wege steht, eben die räumliche Trennung, zu beseitigen, steigen von ihren Bergen herab und siedeln, ohne bei ihrem Umzug auf nennenswerten Widerstand zu stoßen, dorthin über, wo sie tatsächlich längst ihre ökonomische Basis haben, nämlich in die von den reichen Stämmen bewohnten und bewirtschafteten fruchtbaren Flußregionen. Sie unterwerfen die reichen Stämme, okkupieren ihr Gebiet, machen sich zu Herren über ihre agrarisch-städtischen Kulturen und verwandeln so die Schmarotzerbeziehung, die sie bislang in Form einer räuberischen Praxis den reichen Stämmen ebenso unordentlich wie äußerlich oktroyiert haben, in ein von den reichen Stämmen selbst getragenes, ebenso ordentliches wie internes Ausbeutungsverhältnis. Zugleich hört dieses als der Regelfall institutionalisierte Ausbeutungsverhältnis auf, die wegen ihrer einseitigen Begünstigung der Bergstämme als solche erkennbare eindeutige Schmarotzerbeziehung von vorher zu sein, und nimmt die Züge einer Art von wechselseitiger Zweckgemeinschaft oder Symbiose an. Weil nämlich die Gemeinschaft neuen Musters gleich mehrfach und in getrennten, häufig aneinander angrenzenden Regionen entsteht, und weil die frühere Bergheimat der in die Flußtäler Eingefallenen sich rasch wieder mit kriegerisch-räuberischen Stämmen der alten Provenienz auffüllt, sehen sich die entstandenen Gemeinschaften teils von wehrhaften Nachbarn mit Expansionsgelüsten bedrängt, teils durch angriffslustige Räuber mit Okkupationsneigung bedroht und weisen nun ihren neuen Herren die deren Herkunft und Ausbildung angemessene Aufgabe einer Abwehr beziehungsweise Beseitigung dieser zweifachen Gefahr von außen zu. Als Gegenleistung für das Privileg, sich den Überfluß, den die in der neu entstandenen Gemeinschaft zur arbeitenden Schicht degradierten reichen Stämme produzieren, im Angesicht der letzteren ungehindert und anerkanntermaßen aneignen zu dürfen, müssen die als kriegerische Oberschicht etablierten armen Eroberer jenen äußeren Gefahren die Stirn bieten und dafür Sorge tragen, daß der mit der neuen Gemeinschaft eingetretene Status quo sei's erhalten und gesichert bleibt, sei's gar bekräftigt und ausgebaut wird. Auch wenn diese Gefahren, denen die kriegerischen Oberschichten zu wehren berufen sind, eigentlich Bedrohungen sind, die teils nur die Oberschichten selber betreffen, teils überhaupt erst durch deren Anwesenheit heraufbeschworen werden und Aktualität gewinnen, und auch also, wenn hier in einer Art von sich selber exekutierender Prophetie das Abwehrmittel eben das Problem strukturell allererst ins Spiel bringt, das es anschließend funktionell zu bewältigen dient, bleibt doch, was die kriegerischen Oberschichten tun, eine im Sinne der Aufrechterhaltung des gesamtgesellschaftlichen Status quo – eines Status quo, der ja wesentlich durch die Anwesenheit der letzteren selbst definiert ist – als erwünscht und nützlich angesehene Funktion; von daher zeigt sich die frühere einseitige Schmarotzerbeziehung in eine von allen Beteiligten als solche anerkannte wechselseitige Zweckgemeinschaft überführt. Als derart erhaltenswert erweist sich dabei der mit der Etablierung der fremden Eroberer erreichte Status quo, daß dort, wo er durch eine erfolgreiche Invasion oder Okkupation verletzt oder in Frage gestellt wird, die betreffenden Gemeinschaften nichts Eiligeres zu tun haben, als ihn mit Hilfe der Invasoren beziehungsweise Okkupatoren wiederherzustellen und nach gehabtem Muster zu organisieren, so daß, was theoretisch Gelegenheit sein könnte, zum früheren Zustand der Autochthonie und bodenständigen Herrschaft zurückzukehren, praktisch immer nur Anlaß wird, in Form einer bloßen Auswechslung fremder Eliten die Haltbarkeit und den Bestand des neuen, der ursprünglichen Gemeinschaft von außen oktroyierten Herrschaftsverhältnisses zu bekräftigen.
Was aber macht das neue Herrschaftsverhältnis und den mit ihm erreichten gesellschaftlichen Status quo für die Beteiligten derart erhaltenswert? Es ist die innerweltliche Wendung, die im Hinblick auf den Umgang mit gesellschaftlichem Reichtum dieses neue Verhältnis ermöglicht, der Ausweg, den es aus eben der totenkultlichen Sackgasse eröffnet, in die die frühere Herrschaft mit ihrem Verhalten zum Reichtum sich verrennt. Dadurch nämlich, daß ein fremdbürtiger Eroberer und selbstherrlicher Sieger den bis dahin als Herr des Reichtums fungierenden autochthonen Stellvertreter des Toten mit kriegerischer Gewalt aus seiner Stellung verdrängt und ohne alle pompes funèbres in seiner Funktion ersetzt, wird jener weltflüchtig-totenkultliche Bann gebrochen, jener katabolisch-chthonische Zwang suspendiert, der des Stellvertreters Beziehung zum Reichtum bis dahin beherrscht und ihn daran gehindert hat, die ihm eigentlich zugedachte Aufgabe einer Arretierung des Reichtums im Diesseits und Stabilisierung des Überflusses in der Immanenz zu erfüllen. Der ihm zugedachten Aufgabe zu genügen vermochte ja der bisherige Statthalter des Toten deshalb nicht, weil der Tote, an dessen Statt er den Überfluß verwaltete, ihm als sein eigenes Vorbild im Leben, sein einstiger Vorgänger auf Erden vor Augen stand, als dessen personales Ebenbild im Tode, dessen künftiger Nachfolger unter der Erde er dementsprechend sich selber wahrnehmen mußte. Sowenig der bisherige Stellvertreter in dem Toten, dessen Stelle er vertrat, anderes erkennen konnte als die zur personalen Einheit verdichtete lange Reihe derer, die ihm sein Leben vorgelebt hatten und ihm auf Erden vorausgegangen waren, sowenig blieb ihm anderes übrig, als dem vom Verschiedenen ausgehenden Nachfolgedruck nachzugeben und sich im Leben bereits mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften auf das Sein des Verschiedenen als seine dermaleinst eigene Existenz im Jenseits zu projizieren, sich auf Erden schon mit seinem ganzen verfügbaren Vermögen mit der Identität des Toten als seiner künftig eigenen transzendenten Sichselbstgleichheit zu identifizieren. Das heißt, es blieb ihm gar nichts anderes übrig, als bei der Wahrnehmung seines ökonomischen Privilegs und Ausübung seiner politischen Gerechtsame so zu verfahren, wie er verfuhr: nämlich den Reichtum, den er als Statthalter in Anspruch nahm, unmittelbar in eine jenseitige Seinsbestimmung umzusetzen, dem Überfluß, den er stellvertretend mit Beschlag belegte, direkt zur Gußform eines transzendenten Existentials zu verhelfen. Den Reichtum unter den Bedingungen des solchermaßen bestehenden katabolischen Nachfolgedrucks und chthonischen Wiederholungszwangs als diesseitige Bestimmtheit verteidigen zu wollen, hätte für den Stellvertreter bedeutet, Zeugnis gegen seine gewisseste Überzeugung abzulegen und seinem todsichersten Interesse zuwiderzuhandeln. Wer hätte so viel Selbstverleugnung, um nicht zu sagen Selbstentfremdung, von ihm erwarten, geschweige denn verlangen können?
Eben jenem chthonischen Wiederholungszwang macht nun aber der Wechsel vom autochthonen Statthalter und grundständigen Herrn zum fremdstämmigen Besetzer und autonomen Herrscher definitiv ein Ende. Weder in specie seines unmittelbaren Vorgängers, für dessen Beseitigung er gegebenenfalls eigenhändig Sorge getragen hat, noch in genere der zu personaler Einheit verdichteten Reihe von mittelbaren Vorgängern, um deren Repräsentation er nun auf jeden Fall höchstpersönlich sich kümmert, findet der neue Herr des Reichtums und Verwalter des Überflusses Grund und Gelegenheit, an jenes Verhältnis von verpflichtendem Vorgängertum und verbindlicher Nachfolgerschaft wiederanzuknüpfen, das die frühere Herrschaft in Bann schlug und in ihrem ganzen Verhalten determinierte. Schließlich zerstört der neue Herrscher dadurch, daß er seinen unmittelbaren Vorgänger, statt ihn nach einem natürlich erlittenen Tod mit allem Pomp und Aufwand zu Grabe zu tragen und ins Jenseits vorauszuschicken, vielmehr eigenhändig von der Erde tilgt beziehungsweise mitten im Leben verdrängt, exakt das zentrale Glied, das nötig wäre, um ihn mit der Kette seiner mittelbaren Vorgänger zusammenzuschließen und auf deren unterweltliche Existenz projektiv abzubilden beziehungsweise zur Identifikation und Teilhabe mit ihrer Form totenkultlichen Überlebens zu bestimmen. Und schließlich bringt er mit der Zerstörung dieses entscheidenden Glieds in der Kette die letztere ja auch um eben die figürliche Komplexion und anschauliche Gestalt, die erforderlich wäre, um sie für ihn, den Fremdbürtigen, den mit ihr keine genealogische Kontinuität beziehungsweise lebensgeschichtliche Tradition verbindet, überhaupt erst die spezifisch menschliche Identität des in die Unterwelt gefahrenen persönlichen Vorgängers und ins Totenreich übergewechselten paradigmatischen Artgenossen gewinnen zu lassen. So wie er, der von draußen Eingedrungene, in der Stammesheimat seine eigenen Vorgänger hat und von Haus aus in einer anderen Nachfolge steht, so tritt ihm nun jene Reihe von Vorgängern, auf die der neu errungene Reichtum ihn verpflichtet und zu deren Stellvertreter der kürzlich appropriierte Überfluß ihn erklärt, in der Gesichtslosigkeit und Anonymität einer jeden persönlichen Bezugs ermangelnden abstrakten Instanz ex improviso des erworbenen Reichtums, einer aller artspezifischen Verbindung entkleideten diskreten Funktion de profundis des appropriierten Überflusses entgegen. Aller stammesgeschichtlichen Kontinuität mit dem fremden Eroberer entbehrend und durch die im Zuge der Eroberung zwangsläufige Zerstörung des einzig möglichen Verbindungsglieds mit ihm zu völliger Anonymität ihm gegenüber verurteilt, nimmt jene Kette von Vorgängern, an deren Statt der Eroberer nun als Herr des Reichtums firmiert, die Züge einer von jedem menschlichen Subjektcharakter entblößten jenseitigen Reichtumsmacht, einer um jede artgemäße Personalität gebrachten transzendenten Herrschaft über den Überfluß an.
Hinzu kommt, daß jene aus der Kontinuität mit dem Diesseits ausgegliederte und in ein unverbundenes Jenseits abgesetzte Vorgängerfolge nicht bloß der Gesichtslosigkeit verfällt und in Anonymität sich verliert, sondern zugleich auch zur Pluralität sich auflöst und in Vieldeutigkeit versinkt. Weil nämlich die Gründung der neuen Zweckgemeinschaften zwischen nomadisch-kriegerischen und agrarisch-städtischen Stämmen, die zwar nicht völlig gleichzeitig, wohl aber ungefähr gleichsinnig in verschiedenen Flußregionen und fruchtbaren Gebieten der Alten Welt vor sich geht und zu den ersten Großreichen der menschlichen Geschichte führt, normalerweise die Eroberung und Vereinigung einer ganzen Reihe von agrarisch-städtischen Stammesgemeinschaften, die in der betreffenden Region siedeln, sei's zur Voraussetzung, sei's zur Folge hat, finden sich die nomadisch-kriegerischen Eroberer ex improviso des ihnen in die Hände fallenden Reichtums nicht nur mit einer, sondern gleich mit mehreren anonymisierten Folgen von Vorgängern konfrontiert, die das aller genealogischen Verbindung mit dem Diesseits beraubte Jenseits, die jeder lebensgeschichtlichen Kontinuität mit der Immanenz bare Transzendenz mit einer Vielzahl von abstrakten Mächten und diskreten Herrschaften bevölkern. So viele verschiedene Stätten autochthon-eigenständiger Herrschaft die neuen Fremdherrscher erobern und so viele lokale Zentren agrarisch-städtischen Reichtums sie im Zuge ihrer Reichsgründungen okkupieren, so viele jenseitige Mächte und transzendente Herrschaften bringt der neuerworbene Reichtum reminiszierend in Anschlag, um fortan ihnen, seinen neugekürten Verwesern, die also Aufgebotenen in der Gesichtslosigkeit von Gestalten, mit denen sie keinerlei lebensgeschichtliche Wirklichkeit mehr verbindet, und in der Vieldeutigkeit von Wesen, die ihnen alles, bloß keine genealogische Konsequenz mehr signalisieren, ebenso topisch entrückt vom Leibe wie systematisch präsent vor Augen zu halten.
Wie sollte zwischen den Eroberern und den dergestalt anonymisierten und pluralisierten jenseitigen Herren des Reichtums ein nach altem Muster konzipiertes Verhältnis von Vorgängerschaft und Nachfolgertum sich noch herstellen können? Jener Anonymisierung und Pluralisierung der jenseitigen Macht fällt ja eben das augenscheinlich zum Opfer, was als die entscheidende Voraussetzung für allen auf ihren Statthalter auf Erden ausgeübten Zwang zur Nachfolge erscheint: daß nämlich die jenseitige Macht zuvor selber als Herr des Reichtums auf Erden gewandelt ist, die transzendente Herrschaft selber vordem als Überflußeigner im Leben geweilt hat, daß sie mithin in ihrer jenseitigen Form als ein aus dem Leben Geschiedener erinnerlich, in ihrer transzendenten Fassung als Toter erkennbar bleibt. Nur solange kraft lebensgeschichtlicher Kontinuität die jenseitige Macht als diejenige erinnerlich bleibt, die, wie einerseits die Gegenwart ihres Statthalters auf Erden selber zur Vergangenheit, so andererseits dessen eigene Zukunft zur Gegenwart hat, und nur sofern also dank genealogischer Konsequenz die transzendente Herrschaft als der aus dem Diesseits ins Jenseits fortgegangene, aus der Immanenz in die Transzendenz übergewechselte Artgenosse erkenbar bleibt, kann sie für ihren Stellvertreter im Leben jene Vorgängerrolle spielen und jene vorbildliche Funktion übernehmen, die diesen veranlaßt, sich perspektivisch auf sie zu projizieren, antizipatorisch mit ihr zu identifizieren, und die ihn dadurch zwingt, sich auf Erden bereits nach den Forderungen seiner projektiert künftigen, unterirdischen Existenz zu richten, sich im Leben bereits um die Bedürfnisse seiner antizipiert späteren, totenkultlichen Identität zu kümmern. Indem nun mit dem Einbruch der fremdbürtig neuen Herren jene lebensgeschichtliche Kontinuität und Verbindung zerreißt, jene genealogische Konsequenz und Kette abbricht, hört die jenseitige Macht uno actu ihrer Anonymisierung und Pluralisierung auf, für ihren Stellvertreter im Leben jene Rolle des als seinesgleichen ins Jenseits vorangegangenen Verschiedenen, des in die Transzendenz übergewechselten toten Artgenossen zu spielen. Verschieden ist für den Statthalter die jenseitige Macht jetzt nicht mehr in der Konsequenz eines von ihm her gesehenen prospektiven Anderswerdens, sondern in der Logik eines ihm gegenüber erscheinenden distinktiven Andersseins, aus dem Leben ist für den Stellvertreter die transzendente Herrschaft nicht mehr im Resultat eines ihn potentiell einschließenden dynamischen Sphärenwechsels, sondern im Prinzip eines ihn aktuell ausschließenden topischen Gegensatzes der Sphären. Was dort noch die jenseitige Macht ihrem Statthalter auf Erden als seine existentiell eigene Möglichkeit mittelbar vorführt, das stellt sie ihm hier als eine prinzipiell andere Wirklichkeit unmittelbar entgegen, wo mit der transzendenten Herrschaft ihr Stellvertreter im Leben zuvor noch die einholbar künftige Identität seiner selbst im Blick hat, da hat er jetzt nurmehr die zu seinem gegenwärtigen Dasein uneinholbar ewige Alternative vor Augen.
Tatsächlich ist durch das Zerreißen der genealogischen Verbindung und durch den Abbruch der lebensgeschichtlichen Kontinuität die jenseitige Macht um alle der Erde verhafteten, chthonischen Qualitäten gebracht und jeglicher aufs Leben rückbezüglichen, totenkultlichen Relevanz beraubt. Aus dem durch empirische Befreiung vom Los der Sterblichkeit sich etablierenden plutonischen Fürsten wird der kraft dogmatischer Freiheit vom Los der Sterblichen existierende olympische Gott, aus der durch historische Entfernung von der Welt Gestalt annehmenden unterirdischen Macht wird die in systematischer Ferne zur Welt in Erscheinung tretende unirdische Instanz. Durch die Anonymisierung und Pluralisierung des in ihnen weilenden wahren Herrn des Reichtums aller biographisch-chthonischen Beziehung und genealogisch-totenkultlichen Bedeutung entkleidet, legen Jenseits und Transzendenz jeden Zug einer vom Diesseits sich herleitenden Wirklichkeit und mit der Immanenz vermittelten Befindlichkeit ab und nehmen den Charakter statt dessen des in falscher Unmittelbarkeit unvordenklich Bestehenden und der in unhinterfragbarer Faktizität natürlichen Gegebenheit an. Wie sollte wohl von einem Jenseits, das sich in limitativer Unbedingtheit dergestalt zur naturgegebenen Sphäre der Unsterblichen verselbständigt, von einer Transzendenz, die sich im unendlichen Urteil solcherart zur seit jeher bestehenden Götterwelt absondert, für den Statthalter auf Erden noch ein zu Imitationsanstrengungen herausfordernder Projektionszwang, ein zum Versuch der Nachfolge motivierender Identifikationsdruck ausgehen können? So himmelweit die Unsterblichkeit der anonymisiert jenseitigen Macht und die Göttlichkeit der pluralisiert transzendenten Herrschaft entfernt davon sind, noch länger als biographische Konsequenz eines qua Abschied vom Diesseits vorangegangenen Akts des Sterbens und als genealogisches Resultat eines qua Ausscheiden aus der Immanenz vorausgesetzten Todesfalls zu erscheinen, so denkbar fern liegt es nun auch dem Statthalter auf Erden, sich mit allen für sein diesseitiges Dasein daraus entstehenden Folgen noch länger an der Existenz der jenseitigen Macht das Beispiel seines eigenen künftigen Seins nach dem Tode beziehungsweise die Verschiedenheit der transzendenten Herrschaft zum Vorbild für seine eigene spätere Identität zu nehmen.
Befreit vom chthonisch-totenkultlichen Nachfolgedruck, kann der neue Herr als theokratischer Statthalter der Götter fest im Diesseits Fuß fassen und mit dem Reichtum nach irdischem Gutdünken schalten und walten. Sowenig die Götter dem Priesterkönig zu seinen Lebzeiten ins Handwerk pfuschen, sosehr stehen sie im Falle seines Todes bereit, durch ihren formalen Eigentumstitel auf den Reichtum jedem Wiederaufleben des früheren Totenkults zu wehren. Außer im Sonderfall Ägypten, wo die Umstände der Staatsbildung den Herrscher zu einem Kompromiß zwischen totenkultlichem Wiederholungszwang und götterkultlicher Emanzipation nötigen, scheint so die theokratische Herrschaft für eine dauerhafte Zentrierung des Reichtums im Diesseits wie geschaffen.
Damit ist dank äußerer historischer Fügung jener plutonisch-schatzbildnerische Wiederholungszwang und chthonisch-totenkultliche Nachfolgedruck plötzlich verschwunden, dem aus inneren genealogischen Gründen der Statthalter auf Erden sich partout nicht zu entziehen vermochte und der ihn bislang daran hinderte, der an sich ihm übertragenen Aufgabe einer Arretierung des Reichtums im Diesseits und Stabilisierung des Überflusses in der Immanenz in der gewünschten Weise zu genügen. Frei von der Hypothek, einen ins Jenseits Verschiedenen zum nachfolgeheischenden Vorgänger, einen transzendenten Toten zum zukunftsträchtigen Vorbild zu haben, kann der neue, fremdbürtige Stellvertreter nun endlich bei der Verwahrung und Verwaltung des Reichtums jene ungehinderte Diesseitigkeit an den Tag legen, die der alte, autochthone Überflußverwalter nolens volens seiner Projektion auf den verschiedenen Vorgänger und Identifizierung mit dem toten Paradigma zum Opfer brachte. Bei prinzipieller Anerkennung des Rechtsanspruchs der im Jenseits weilenden wahren Herren des Reichtums und formeller Bestätigung ihres Eigentumsvorbehalts kann jetzt ihr Statthalter auf Erden, ohne von ihrer in die generische Verschiedenheit entrückten jenseitigen Existenz sich noch länger stören lassen zu müssen, mit dem Reichtum schalten und walten, wie es seinem diesseitigen Dasein frommt, kann ihr Stellverteter im Leben, ohne auf ihre zu limitativer Absolutheit erhobene transzendente Verfassung noch im mindesten Rücksicht nehmen zu müssen, mit dem Überfluß tun und lassen, was ihn in seiner immanenten Befindlichkeit gut dünkt. Sowenig die zu unsterblichen Göttern anonymisierten und pluralisierten jenseitigen Mächte ihm noch etwas sub specie seiner eigenen sterblichen Natur Wesentliches zu bedeuten vermögen, noch etwas in specie seines eigenen menschlichen Schicksals Erhebliches zu sagen haben, sowenig können sie ihren Statthalter noch davon abhalten beziehungsweise abbringen, seine auf die Arretierung des Reichtums im Diesseits gemünzte Funktion im Leben zu erfüllen. Auf geradezu paradoxe Weise gewinnt so der Statthalter eben dadurch, daß er alle genealogische Affinität zum wahren Herrn des Reichtums, alle artgenossenschaftliche Identität mit dem wirklichen Überflußeigner verliert und sich dem letzteren gegenüber auf die Stellung eines strikt offiziellen Vertreters beschränkt, mit der Rolle eines rein professionellen Funktionärs bescheidet, eine ganz unerhörte Macht über den gesellschaftlichen Reichtum. In dem Maß, wie die Anonymisierung des plutonisch-chthonischen Toten zu ätherischen Unsterblichen, seine Pluralisierung zu olympischen Gottheiten den Statthalter auf Erden aller Beziehung zum Jenseits und transzendenten Bewandtnis beraubt, verleiht sie seinem Bestehen im Diesseits ein völlig anderes Gewicht und eine ganz neue Befugnis. Weil es die eigene Aussicht auf eine künftige Existenz im Jenseits war, die den Stellvertreter dazu bestimmte, seinen diesseitigen Umgang mit dem Reichtum den Forderungen der jenseitigen Macht zu unterwerfen und an den Bedürfnissen der transzendenten Herrschaft auszurichten, bedeutet der in der Anonymisierung und Pluralisierung der letzteren beschlossene Verlust jener Aussicht für ihn zugleich den Gewinn einer in seinem diesseitigen Umgang mit dem Reichtum neuen Eigenständigkeit und anderen Selbstbezüglichkeit. Indem er die unsterblichen Wesen vorbehaltlos als die wirklichen Überflußeigner anerkennt, sich ihnen gegenüber rückhaltlos zu seiner Statthalterfunktion bekennt, tut er dadurch ihrem Herrschaftsanspruch und Eigentumsvorbehalt in aller Form Genüge und nimmt ihnen jede Möglichkeit, auf dem alten, quasi direkten Weg seiner projektiven Selbstabbildung auf sie realen Einfluß auf ihr diesseitiges Hab und Gut zu nehmen und in der früheren, gewissermaßen persönlichen Weise seiner antizipatorischen Identifikation mit ihnen materialiter Hand auf ihren immanenten Besitz zu legen.
So gesehen, gewinnt der Statthalter gerade dadurch, daß er alle Ambitionen auf Teilhabe an der jenseitigen Macht, alle Aspirationen auf Einsetzung in die transzendente Herrschaft aufgibt, in der diesseitigen Statthalterschaft, auf die er sich beschränkt, eine, wenn man so paradox formulieren darf, relative Absolutheit und partielle Totalität. Er ist Bevollmächtigter, auf den seine Vollmachtgeber, die Unsterblichen, nach dem formalen Akt seiner Bevollmächtigung keinerlei materialen Einfluß mehr haben, ist Autorisierter, in Ansehung dessen die göttlichen Autoritäten keine über das prinzipale Fakt der ihm erteilten Befugnis hinausreichende reale Handhabe mehr besitzen. Während die Unsterblichen sich in die anonyme Ferne ihres ebenso formalen wie unverbrüchlichen Herrschaftsanspruchs absetzen, die Götter in den pluralischen Hintergrund ihres ebenso obsoleten wie prinzipalen Eigentumsvorbehalts zurücktreten, hält und befestigt ihr Statthalter als in aller Form eingesetzter theokratischer Verweser die Stellung ihrer im Reichtum bestehenden diesseitigen Domäne, behauptet und bestellt er als mit voller Prokura ausgestatteter Priesterkönig das Feld ihres als Überfluß firmierenden immanenten Eigentums. In ihrer alle biographischen Hoffnungen vereitelnden, unwiderruflich topischen Abwesenheit und alle genealogischen Aspirationen zunichte machenden, unüberbrückbar systematischen Verschiedenheit lassen die wahren Herren des Reichtums ihren Stellvertreter als einen Repräsentanten, einen Regenten zurück, der ihre Macht auf Erden vollständig monopolisiert, ihren Willen im Leben zur Gänze personifiziert und der kraft dieser ihm übertragenen theokratisch uneingeschränkten Regentschaft, kraft dieser ihm verliehenen priesterköniglich absoluten Vollmacht den Reichtum an eben das Diesseits bindet, das sein eigenes ausschließliches Zuhause ist, den Überfluß in eben der Immanenz festhält, in die er selber mit Leib und Seele hineingehört.
Sosehr diese von jeder Aspiration auf ein in biographischer Konsequenz unsterbliches Sein freie theokratische Prokura zwar offenbar dazu taugt, zu Lebzeiten des Priesterkönigs dem gesellschaftlichen Reichtum eine effektiv immanente Zentrierung zu gewährleisten, sosehr scheint sie allerdings auch geeignet, im Augenblick des Todes des Priesterkönigs frühere, den Reichtum betreffende Irrealisierungsängste und Entwertungstraumata neu zu schüren. Gerade weil der theokratisch-priesterliche Herrscher bei aller formalen Unterwerfung unter die Macht der Unsterblichen und offizialen Abhängigkeit vom Willen der Götter eine so ungestörte materiale Prokura und uneingeschränkte reale Vollmacht über den Überfluß besitzt und gerade weil er also bei aller prinzipiellen Botmäßigkeit gegenüber dem Jenseits und konstitutionellen Transzendenzhörigkeit das Diesseits residentiell so ganz und gar okkupiert und die Immanenz institutionell so völlig beherrscht, droht sein Tod die frühere Bedeutung einer das Diesseits als solches irrealisierenden unendlichen Indifferenzbekundung wieder anzunehmen, die alten Züge eines die Immanenz in toto entwertenden Akts absoluter Negativität neu hervorzukehren. Indem er, der kraft theokratischer Repräsentativität die materiale Stellung des irdischen Diesseits gegen alle formalen Ansprüche des olympischen Jenseits behauptende, kraft priesterlicher Personalität die reale Sache der Immanenz gegen alle kategorialen Vorbehalte der göttlichen Transzendenz vertretende Herr und König mit Tode abgeht, droht seine Abwendung vom reichtumhaltigen Diesseits, dies Ausscheiden aus der überflußerfüllten Immanenz die frühere Bedeutung eines vom Reichtum selbst reminiszierend vorgestellten unendlichen Urteils über die Realität des Diesseits wieder anzunehmen, die alte Pointierung eines vom Überfluß selber remonstrativ kommentierten absoluten Verdikts über den Wert der Immanenz zurückzugewinnen. So, wie der theokratische Herr de facto die alte Funktion eines grundlegend konstitutiven Seins und eines haltgebend initiativen Prinzips für die von Überfluß erfüllte Immanenz als solche übernimmt, droht sein Verscheiden die fatale Bedeutung eines dem Diesseits das Sein entziehenden und damit es als solches des Scheins überführenden ontologischen Sprungs in ein unbedingtes Jenseits, die schicksalhafte Pointe eines der Immanenz das Prinzip verschlagenden und also sie als ganze für grundlos erklärenden historiologischen Ausbruchs in absolute Transzendenz neu hervorzukehren. Was Wunder, wenn auf die also erneuerte Gefahr einer wie zwischen Schein und Sein indifferentistisch aufreißenden ontologischen Kluft, eines wie zwischen Illusion und Wirklichkeit negativistisch durchschlagenden historiologischen Sprungs die Gesellschaft mit dem altbewährten Rezept, wenn schon nicht Heilmittel, einer chthonisch-plutonischen Identifizierung des Verschiedenen und totenkultlichen Integration des Toten regiert? Was Wunder, wenn sie den verschiedenen Theokraten dadurch aus seiner unbedingten Indifferenz heraus- und in eine spezifische Differenz zu ihrer eigenen Sphäre zurückzubringen, den toten Priesterkönig dadurch seiner absoluten Negativität zu entreißen und eines bestimmt negativen Verhältnisses zu ihrer eigenen Welt zu überführen sucht, daß sie in altbewährter Manier teils sein Jenseits als unterirdische Domäne räumlich an ihr oberirdisches Diesseits anzuschließen bestrebt ist, teils alle Anstrengungen unternimmt, ihn, den Unterirdischen selbst, durch die Übertragung von Reichtum nicht bloß in relativer Kontinuität zu seinem vorherigen, oberirdischen Dasein erscheinen, sondern mehr noch in suggestiver Identität mit seiner früheren, innerweltlichen Identität sich behaupten zu lassen?
Wenn so aber die Gesellschaft ihren im Namen anonymer Unsterblicher theokratisch über die Sterblichen herrschenden Herrn, ihren als Repräsentant einer Vielzahl von Göttern allmächtig auf Erden regierenden König mit seinem Tod die alte Gefahr einer fundamentalen Entwirklichung und Entwertung dessen, wovon er sich abkehrt, heraufbeschwören sieht und wenn sie in alter Weise dieser Gefahr dadurch zu begegnen sich bemüht, daß sie dem Verschiedenen durch seine feierliche Bestattung in einem als Schatzkammer ausgestatteten Grab, seine pompöse Beisetzung in einem als Schatzhaus aufgeführten Mausoleum eben das, wovon er sich abgekehrt hat, als sein bleibendes Hab und Gut, sein fortgesetztes Existential und Bedürfnis nachreicht, läuft sie dann nicht die kaum geringer zu veranschlagende Gefahr, die Tradition des früheren chthonisch-plutonischen Hüters des Reichtums wiederzuerwecken und den Kult des alten katabolisch-thesaurischen Horters von Überfluß neu zu beleben? Geht die Gesellschaft, wenn sie das vom toten Priesterkönig angenommene transzendente Sein, um es daran zu hindern, seine drohende Bedeutung historiologisch absoluter Negativität zu entfalten, als eine an die Immanenz des weltlichen Daseins topisch anschließende unterweltliche Residenz des Toten dingfest macht, nicht in der Tat das, nach früheren Erfahrungen zu schließen, unkontrollierbare Risiko ein, um der Erreichung einer unerreichbaren Kontinuität zwischen Diesseits und Jenseits oder der Erhaltung einer unhaltbaren Identität zwischen Immanenz und Transzendenz willen dem alten totenkultlichen Zwangsmechanismus eines katabolisch unaufhörlichen Transfers des im Diesseits geschaffenen Reichtums an seinen im Jenseits weilenden plutonisch wahren Herrn, einer fluchtpünktlich fortlaufenden Übereignung des von der Immanenz erzeugten Überflusses an seinen in der Transzendenz thronenden chthonisch wirklichen Eigner wieder in Kraft zu setzen? Und falls sie diesem totenkultlichen Zwangsmechanismus durch die Einsetzung eines die Stellung auf Erden zu halten bestimmten Statthalters des Verschiedenen, eines dem Leben die Stange zu halten gedachten Stellverteters des Toten zu begegnen versucht, setzt sie den letzteren dann nicht wohl oder übel jenem alten unwiderstehlichen Nachfolgedruck aus, der, statt die vorgesehene diesseitige Reaffirmation des Reichtums zuzulassen, vielmehr einzig und allein zu dem geschilderten Resultat führt, daß der Reichtum in statu nascendi bereits in die Gußform seiner jenseitigen Bestimmtheit gebracht wird, der Überfluß quasi spontan und automatisch die Gestalt eines für die Transzendenz gemachten Existentials annimmt?
Indes, daß dies geschieht und daß also der alte, mit der Einsetzung eines Repräsentanten des Toten zum genealogischen Selbstvollzug automatisierte Totenkult neu in Kraft tritt, dagegen stehen und davor schützen jetzt die Unsterblichen mit ihrem in aller Anonymität nominalen Besitzanspruch auf den Reichtum, ihrem in aller Pluralität formalen Eigentumsvorbehalt in Sachen Überfluß. Sie in ihrer unsterblichen Existenz verhindern, daß der verstorbene Priesterkönig an die alte chthonisch-plutonische Position eines Fürsten der Unterwelt wiederanknüpfen und den Reichtum als sein Eigen mit Beschlag belegen kann. Wie zu seinen Lebzeiten er, der von allem Nachfolgedruck befreite hohepriesterlich bevollmächtigte Statthalter, sie, die zu Unsterblichen anonymisierten Verschiedenen, zu Göttern pluralisierten Toten in die Schranken eines nurmehr formalen Anspruchs und nominalen Titels auf den Reichtum weist, so halten nun umgekehrt sie kraft dieses formalen Anspruchs ihn in Schach, da er im Tode Anstalten macht, in die alte, unterweltlich reale Stellung eines jenseitigen Herrn des Reichtums zurückzufallen. So dringlich es der Gesellschaft erscheinen muß, den toten theokratischen Herrn mit allem Pomp und Reichtum zu Grabe zu tragen und in eine aus lauter Überfluß gewirkte letzte Ruhestätte zu betten, um das Menetekel einer das ganze immanente Leben entwertenden absoluten Negativität, das er im Augenblick seines Todes an die Wand malt, abzuwenden und ihn als Unterirdischen in räumlich relativierter Differenz zum irdischen Dasein zu verhalten, ihn als Bewohner des Totenreichs auf eine topisch bestimmte Negation zur Welt der Lebenden zu vereidigen, so getrost kann die Gesellschaft, kaum daß sie ihn solcherart durch pompös-funebren Reichtum relativiert hat, dem also Beigesetzten, also in der Gruft Verstauten unter Berufung auf den Besitzanspruch der Unsterblichen allen weiteren Reichtum vorenthalten, um diesen zur Gänze stattdessen dem neuen Bevollmächtigten der wahren Herren des Reichtums, dem neuen Prokuristen der eigentlichen Eigner des Überflusses, nämlich dem als Stellverteter der Götter jetzt auf Erden waltenden, im Leben schaltenden nächsten Priesterkönig zuzuwenden. Was die Götter brauchen, ist ein Repräsentant, der dafür sorgt, daß ihr jenseitig nominaler Anspruch auf den Reichtum im Diesseits reale Geltung gewinnt, ihr transzendent formales Anrecht auf den Überfluß in der Immanenz seinen materialen Ausdruck findet; was sie hingegen nicht brauchen, ist ein Konkurrent, der ihnen im Jenseits selbst diesen ihren nominalen Anspruch auf den Reichtum streitig macht, um ihn als reale Forderung nach chthonisch-plutonischer Verjenseitigung des Reichtums zu reaktualisieren, der sie in der Transzendenz als solcher dieses ihres formalen Anrechts auf den Überfluß beraubt, um es als materialen Titel auf eine den Überfluß ereilende katabolisch-thesaurische Transzendenzbewegung erneut in Kraft zu setzen. Sobald deshalb der Repräsentant der Götter nach seinem Tode Anstalten macht, sich in deren totenkultlichen Konkurrenten zu verwandeln, ist es die Rücksicht auf die letzteren und ihren wohlverstandenen nominalen Anspruch auf den Reichtum, was es der Gesellschaft erlaubt, dem Aspiranten das plutonisch goldenbödige Handwerk zu legen und die thesaurisch geschmeideglänzende Karriere abzuschneiden. Allen Titels auf eine weitere Versorgung mit Überfluß beraubt, findet sich der fürstliche Tote in der undurchdringlichen Abgeschlossenheit seiner großartig letzten Ruhestätte sich selbst überlassen, in der unverletzlichen Abgeschiedenheit seiner pompös ewigen Bleibe kaltgestellt und hat bestenfalls noch die Möglichkeit, seiner lethalen Isolation und fatalen Einschließung dadurch zu entrinnen, daß er sich unter Preisgabe jeglicher material-thesaurischen Aspiration auf Überfluß der ebenso amorph-ätherischen wie anonym-pluralischen Schar seiner einstigen Patrone und jetzigen Widersacher, der mit einem nurmehr nominalen Anspruch auf den Reichtum abgefundenen Götter, beigesellt.
Sich ungeachtet der Intervention der Götter halbwegs eigenständig zu behaupten und gegenüber den letzteren als ein chthonisch-plutonischer Fürst relativ zu etablieren gelingt dem toten theokratischen Herrn nur unter der besonderen, im geographisch geschlossenen Raum des Nildeltas offenbar gegebenen Bedingung, daß sich die Bildung der als symbiotische Gemeinschaft neuen, stratifizierten Gesellschaft nicht sowohl kraft Invasion von außen, als vielmehr mittels Expansion von innen vollzieht, daß also diese neue, durch das Prinzip einer Vergesellschaftung differenter Gruppen bestimmte Gemeinschaftsform nicht sowohl in der Weise zustande kommt, daß arme, fremdbürtige Stämme von draußen eindringen und die ortsansässigen, reichen Stämme unterwerfen, sondern vielmehr auf die Art, daß ortsansässige, aber durch ihre periphere Lage und relativ ungünstigere Lebensbedingungen benachteiligte und weniger reiche Stämme ihr Gebiet mit Gewalt ausdehnen und die angrenzenden beziehungsweise umliegenden reicheren Stämme unterjochen. Weil in diesem letzteren Fall die Eroberer nicht eigentlich die politische Sphäre und den ökonomischen Lebensraum wechseln, kommt es hier auch nicht zu jener andernfalls unausweichlichen radikalen Zäsur, die einerseits die Eindringlinge zwingt, ihre als chthonische Vorgänger genealogisch eigenen Toten draußen in der Heimat zurückzulassen, und ihnen andererseits erlaubt, die als plutonische Fürsten am Ort vorgefundenen, biographisch fremden Toten zu unvermittelt jenseitigen Mächten und abstrakt transzendenten Instanzen, eben zu unsterblichen Göttern, zu anonymisieren und zu pluralisieren. Während hier, in diesem besonderen Fall, die Eroberer einerseits zwar durch den handgreiflichen Bruch der genealogischen Kontinuität, den sie in den okkupierten Stämmen bewirken, deren fürstliche Tote allen von ihnen ausgeübten unterweltlichen Nachfolgedrucks entkleiden und zur Anonymität überweltlich entrückter Unsterblicher, zur Pluralität olympisch unverbindlicher Götter bestimmen, behalten sie andererseits aber auch ihre durch keinen radikalen Szenen- und Sphärenwechsel unterbrochenen stammeseigenen Beziehungen zur Unterwelt, ihre durch keinen generischen Sprung im Reichtum außer Kraft gesetzten autogenen totenkultlichen Bindungen bei und setzen sie mitten in das durch die abstrakt transzendente Existenz einer Götterpluralität definierte neue Milieu hinein fort. Das Ergebnis dieser für den ägyptischen Sonderfall charakteristischen totenkultlichen Kontinuität beim diskontinuierlichen Übergang von den alten, autochthon-chthonischen Gemeinschaften zur neuen, stratifiziert-symbiotischen Gesellschaft ist ein prekärer Kompromiß zwischen den materialen Verjenseitigungsforderungen, die von seiner genealogisch eigenen Reihe von Toten an den Pharao gestellt werden, und den formalen, rein diesseitigen Repräsentationsansprüchen, mit denen ihn die Menge der zu Gottheiten anonymisierten Toten der unterworfenen Stämme und eroberten Regionen konfrontiert – ein Kompromiß, der den Pharao selbst changieren läßt zwischen der Bedeutung eines mit seinem Sinnen und Trachten strikt aufs Jenseits gerichteten Gasts auf Erden und künftigen Herrschers im Totenreich und der Rolle eines mit seinem Tun und Lassen fest im Diesseits verankerten Stellvertreters auf Erden und theokratisch bevollmächtigten Herrn über die Lebenden – ein Kompromiß, der, ungeachtet seiner prekären Natur, immerhin haltbar genug war, um auch eine Phase reiner, zum Anschluß an die Entwicklung in der übrigen Welt einladender Fremdherrschaft wie die Hyksos-Zeit zu überdauern.
Ohne solchen Kompromiß verläuft die Entwicklung in der übrigen Welt. Während im ägyptischen Ausnahmefall die durch die Reichsgründung zu Göttern aufgehobenen Toten der unterworfenen Stämme und eroberten Territorien ihre Wirksamkeit darin erschöpfen, als weltlich-säkulares Gegengewicht gegen die fortdauernde totenkultliche Orientierung und unterweltliche Fixierung des Herrschers selbst diese in ihrer öffentlichen Bedeutung nach Möglichkeit zu beschneiden und auf die Rolle eines bei aller existentiellen Dringlichkeit von den weltlichen Aufgaben klar unterscheidbaren persönlichen Anliegens des Pharao, einer bei aller zeremoniellen Wichtigkeit mit den Staatsgeschäften als solchen unverwechselbaren herrscherlichen Privatsache einzuschränken, räumen überall sonst jene zu Göttern entmischten Toten gründlich und kompromißlos mit den totenkultlichen Aktivitäten auf. Nicht nur entbinden sie ihren Statthalter auf Erden von allem transzendenzfixierten Wiederholungszwang und stellen ihm, dem jeglicher chthonisch-plutonischer Ambitionen baren irdischen Repräsentanten, das Diesseits mit all seinem Reichtum zur priesterköniglich uneingeschränkten Verfügung, überlassen ihm, dem sämtlicher thesaurisch-unterweltlicher Aspirationen ledigen weltlichen Intendanten, die Immanenz mitsamt ihrem Überfluß zum theokratisch freien Gebrauch – sie sorgen mehr noch dafür, daß die katabolische Dynamik, die der Priesterkönig durch sein Verscheiden neu zu entfesseln droht, nicht zur Entfaltung kommt und im Gestus des Leichenbegängnisses steckenbleibt, im Pomp des Bestattungsrituals sich erschöpft, daß also dem jeweils nächsten weltlichen Repräsentanten der Götter der Reichtum, den sie in seine Hand gegeben haben, in ungeschmälert diesseitiger Bedeutung erhalten, als unbestritten immanente Realität verfügbar bleibt. Das einzige, was der theokratische Herr den Göttern für diese zweifache Wohltat der Befreiung von ihrer eigenen chthonisch-abgründigen Vergangenheit und des Schutzes vor der verfänglich-plutonischen Zudringlichkeit seines unmittelbaren Vorgängers schuldet, ist die Anerkennung ihres nominalen Anspruchs auf den Reichtum, die Bestätigung ihres formalen Anrechts auf den Überfluß, ist dies, daß er die Herrschaft auf Erden als namentlicher Prokurist der in ihnen firmierenden wahren Herren des Reichtums zu übernehmen, die weltliche Regierung als förmlicher Repräsentant der in ihnen subsistierenden eigentlichen Eigner des säkularen Überflusses anzutreten einwilligt. Ist er dazu bereit und begleicht er diese Schuld gegen die Götter, so hat er fortan freie Hand und kann mit dem Reichtum, den jene ihm gegeben, verfahren, wie es ihn gutdünkt, tun und lassen, was ihm gefällt. So unbeschränkt durch alle realiter reziproke Verpflichtung gegenüber den Überirdischen ist die ihm auf Erden verliehene Prokura und so frei von jeder den Göttern geschuldeten materialiter resultativen Rechenschaft, daß angesichts dessen seine Anerkennung des nominalen Anspruchs der Götter auf den Reichtum zu einer nichtssagend nominellen Beteuerung verblaßt, zu einer bedeutungslos formellen Geste verkommt, zu einer Formalie und Floskel, deren Los es ist, daß sie von eben der Faktizität, die sie de jure in Kraft setzt und sanktioniert, selber de facto entkräftet und in ihrer Bedeutung minimisiert, von eben der Evidenz, die systematisch ihr Werk ist und durch sie Geltung erhält, empirisch zum unerheblichen Korollar erklärt und in ihrer Stellung marginalisiert wird. Derart ungestört ist die dem Priesterkönig auf Erden verliehene Prokura, daß im Rückblick von ihr her auch und sogar der Akt ihrer Verleihung selbst alle konstitutive Notwendigkeit einbüßt und sich als der überflüsssige Formalismus einer bloßen Affirmation dessen, was ohnehin der Fall ist, enthüllt; derart ungeteilt ist die dem theokratischen Herrn im Leben erteilte Vollmacht, daß unter ihrem Eindruck rückwirkend sogar das Fakt ihrer Erteilung als solches bar jeder maßgebenden Bedeutung erscheint und sich als die entbehrliche Zutat einer reinen Status-quo-Sanktionierung zu erkennen gibt.
Die dem Priesterkönig verliehene Vollmacht tendiert dazu, kraft ihrer empirisch überwältigenden Präsenz die Götter mitsamt ihrem nominalen Eigentumsanspruch in Vergessenheit geraten zu lassen und damit den ersteren in jene Position grund- und legitimationsloser Machtausübung zurückzubringen, die ihm schon einmal die Mißgunst und die Todeswünsche der Gemeinschaft zuzog. Weil sich die Gemeinschaft zugleich aber erinnert, daß diese Situation Ausgangspunkt des nach dem tatsächlichen Tod des Herrn raumgreifenden Totenkults war, schreckt sie vor deren Wiederholung zurück und sinnt auf ein Mittel, dem theokratischen Herrn seine Legitimation zu erhalten.
Eben dies indes, daß jene Prokura materialiter bedingungslos genug ist, um den Akt ihrer nominalen Gewährung zur nichtssagenden Floskel zu erklären, führt am Ende zu der Situation, daß die Gesellschaft die überflüssig nominellen Geber solcher bedingungslosen Prokura überhaupt aus dem Auge verliert und sich mit dem Anblick einer mangels unsterblicher Urheber nurmehr in der eigenen Faktizität gründenden herrscherlichen Macht über den Reichtum konfrontiert sieht, sich dem Eindruck einer mangels göttlicher Stifter quasi naturgegeben erscheinenden autokratischen Verfügung über den Überfluß ausgesetzt findet. Dergestalt prädominant ist die dem Priesterkönig verliehene irdische Macht und weltliche Befugnis, daß sie schließlich der Gesellschaft alle Gedanken an ihre pro nomine überirdischen Urheber austreibt, jede Erinnerung an ihre pro forma göttlichen Stifter verschlägt und sich der allgemeinen Vorstellung als das datum nudum einer aller Legitimation überhobenen selbstherrlich-existentialen Gewalt präsentiert, sich im öffentlichen Bewußtsein als das factum brutum einer von Natur gegebenen eigenmächtig-totalen Herrschaft etabliert. Und damit findet sich denn aber die theokratische Gesellschaft in einer Lage vergleichbar derjenigen wieder, in die vormals das mit Priorität auf den Reichtum versehene andere Subjekt mythologisch-heroischer Provenienz die Stammesgemeinschaft versetzte, als dank wachsender Produktivität der Arbeit und entsprechend sich mehrendem Reichtum sein privilegiertes Leben im Überfluß zur festen Einrichtung, zum festlich unverbrüchlichen Status quo wurde. Mit jener – dem Wachstum der Stammesproduktion gedankten – Verwandlung des heroischen Wohllebens in eine unabsehbare Dauerfunktion ging damals zwar ein unbestreitbarer Gewinn an Sicherheit fürs Stammesleben und Berechenbarkeit in der Stammesentwicklung einher. Gleichzeitig allerdings verloren ging mit ihr nicht bloß die Fähigkeit des anderen Subjekts, durch festlich-orgiastisches Aufräumen mit dem Reichtum sich selber in Abständen aus der Welt zu schaffen und so die Stammessubjekte von Zeit zu Zeit seiner bedrückend-provokativen Gegenwart zu entheben, sondern mehr noch und vor allem die in solcher Selbstaufhebung beschlossene Gelegenheit für die Stammessubjekte, im Zuge der Neubildung des Reichtums jenes dem Reichtum entspringende andere Subjekt in der Ursprünglichkeit seiner die ganze Stammesdimension mit Entwirklichung bedrohenden unbedingten Indifferenz erneut zu erleben, in der Uranfänglichkeit seiner die gesamte Stammesperspektive mit Entwertung konfrontierenden absoluten Negativität abermals sich vor Augen zu stellen und damit des guten Grunds für die mit mythologischen Mitteln dem anderen Subjekt eingeräumte Priorität auf den Reichtum ansichtig, der wahren Notwendigkeit für das ihm auf heroologischem Weg übertragene Privileg auf den Überfluß inne zu werden. Sooft das andere Subjekt dadurch, daß es dem Überfluß orgiastisch den Garaus machte, sich selber den Boden entzog, sooft verschaffte es den Stammessubjekten die Möglichkeit, es ex improviso des neuproduzierten Reichtums in einer Bedeutung zu erleben, die ihnen seine mythologisch inszenierte Erhebung zum auserwählten Herrn des Reichtums, seinen heroologisch durchgesetzten Aufstieg zum privilegierten Eigner des Überflusses als das mit Abstand kleinere Übel akzeptabel werden und in der Tat als eine glückliche Errettung aus höchster Not und Gefahr willkommen sein ließ. Indem aber mit der Verwandlung des mythologisch-festlichen Reichtumsgenusses in eine ständige Einrichtung die Gelegenheit zur Begegnung mit jener vom anderen Subjekt ursprünglich drohenden unbedingten Indifferenz und abstrakten Negativität sich unwiederbringlich verlor, nahm die dem anderen Subjekt eingeräumte herrschaftliche Priorität auf den Reichtum für die Stammessubjekte ebenso unaufhaltsam wie sukzessive ein anderes Aussehen an. Seines im traumatischen Widerfahrnis jener Indifferenzdrohung bestehenden guten Grunds beraubt und seiner im unendlichen Schrecken jener Negativerfahrung vorliegenden wahren Notwendigkeit entkleidet, hörte dies herrschaftlich-eignerschaftliche Vor- und Nießrecht des anderen Subjekts auf, den Stammessubjekten als das verhältnismäßig kleinere Übel akzeptabel zu sein, und kehrte allmählich für sie die Züge einer nach Maßgabe seiner Grundlosigkeit unbegreiflichen Zumutung und mangels jeder Notwendigkeit unerträglichen Belastung hervor. In dem Maß, wie die institutionelle Beständigkeit und funktionelle Stetigkeit, die der Reichtum dank Stammesproduktivität entwickelte, das andere Subjekt ein für allemal davor schützte, in jene ursprüngliche Bedrohlichkeit zurückzufallen, die die Stammessubjekte gezwungen waren, ihm mit den mythologischen Mitteln einer kraft archaischer Vorfahrlichkeit bevorzugten Existenz im Reichtum und eines dank kursorischer Vorbildlichkeit privilegierten Lebens im Überfluß abzukaufen, gewann in den Augen der Stammessubjekte die Beschwernis an Gewicht, die jene ständig bevorzugte Reichtumexistenz des anderen Subjekts für sie, die dabei ständig benachteiligten wirklichen Produzenten des Reichtums, bedeutete, fiel ihnen das Ärgernis auf die Seele, das jenes stetig bevorrechtigte Leben des anderen Subjekts im Überfluß für sie, die dadurch stets um ihr Recht gebrachten eigentlichen Erzeuger des Überflusses, darstellte. Mit zunehmender Erbitterung und wachsendem Ressentiment blickten die Stammessubjekte auf jenes im Reichtum schwelgende andere Subjekt, das auf ihre Kosten eine Vorrangstellung behauptete, für die sie keinerlei Grund mehr zu erkennen vermochten, das zu ihren Lasten eine Vorzugsposition einnahm, deren Notwendigkeit ihnen partout nicht mehr einsichtig war. Und mit wachsender Ungeduld und zunehmender Aggressivität warteten sie deshalb auch darauf – oder trugen eigenhändig Sorge dafür –, daß der Tod dem anderen Subjekt seine Vorrangstellung entriß, damit der Reichtum endlich als herrenlos gewordenes Gut und freigesetzte Habe an seine wirklichen Erzeuger zurückfallen konnte.
Mit der im Prinzip gleichen hoffnungsvollen Mißgunst und erwartungsvollen Feindseligkeit wie vormals die Stammesgemeinschaft dem in unerschöpflichem Reichtum fest etablierten, in unversieglichem Überfluß dauerhaft eingelebten anderen Subjekt tritt nun also die als Symbiose von Stammesgemeinschaften neu entstandene Gesellschaft ihrem mit unverbrüchlich schrankenloser Vollmacht bei der Verwaltung des Reichtums ausgestatteten theokratischen Herrn gegenüber. Und sie hat dazu den im Prinzip gleichen Anlaß wie jene: die Verflüchtigung jeder einsehbaren Notwendigkeit für die mit solcher Vollmacht dem theokratischen Herrn konzedierte Vorzugsposition. War es vormals ein als Fortgang der Produktivität beschreibbarer arbeitstechnisch-ökonomischer Fortschritt, der den Stammessubjekten den für das Privileg des anderen Subjekts vorhandenen guten Grund aus dem Blickfeld rückte, so ist es nunmehr ein als Entwicklung in der Sozietät selbst erscheinender militärtechnisch-soziologischer Fortschritt, durch den der neu entstandenen Gesellschaft die für die Vollmacht ihres theokratischen Herrn geltend zu machende einsehbare Notwendigkeit aus den Augen gerät. Solange die jenseitige Macht, als deren Statthalter der auf Erden wandelnde Herr des Reichtums firmiert, noch ein realiter Anspruch auf den Reichtum erhebender chthonisch-unterirdischer Verschiedener ist, liegt dieser gute Grund für die dem Statthalter eingeräumte Handlungsmacht über den Reichtum auf der Hand. Weil der mit Reichtumsmitteln vor dem irrevoziblen Abgang in unbedingte Indifferenz bewahrte und in ein unterirdisches Jenseits eingewiesene Verschiedene, der mit Hilfe von Überfluß vom irreparablen Ausstieg in absolute Negativität abgehaltene und in eine unterweltliche Transzendenz gebannte Tote in der direkten Konsequenz dieser seiner schattenweltlichen Einweisung und totenkultlichen Einbindung die fatale Eigenschaft entwickelt, als der im Jenseits weilende wahre Herr des Reichtums diesen zum plutonischen Existential zu erklären und als thesaurisches Regal mit Beschlag zu belegen, ist der Versuch, durch die Gegeneinrichtung eines irdischen Statthalters des Verschiedenen und durch die solchem Statthalter eingeräumte Macht über den Reichtum dem von chthonisch-jenseitiger Schwindsucht befallenen, von katabolisch-transzendenter Fallsucht überkommenen letzteren eine diesseitige Bedeutung und immanente Zentrierung zurückzugeben, in seiner Notwendigkeit einsehbar. Daß wegen des unwiderstehlichen Zwangs zur lebensgeschichtlichen Projektion auf den chthonischen Herrscher, wegen der übermächtigen Verführung zur genealogischen Identifizierung mit dem plutonischen Fürsten der irdische Statthalter dieser Funktion einer Arretierung des Reichtums im Diesseits erst einmal gar nicht zu genügen vermag und vielmehr selber einer jenseitsorientierten chthonisch-plutonischen Perspektive verfällt, widerlegt dabei nicht etwa die faktische Notwendigkeit jener reichtumarretierenden Statthalterschaft auf Erden, sondern beweist nur die Schwierigkeit ihrer praktischen Durchsetzung, spricht also keineswegs dagegen, daß der Statthalter allen im chthonischen Jenseits bestehenden guten Grund hat, sich als Herr des Reichtums im Diesseits aufzuführen, sondern zeugt einzig und allein davon, wie schwer oder vielmehr unmöglich es ihm wird, angesichts der Anziehungskraft, die dieser im chthonisch-jenseitigen Anspruch auf den Reichtum bestehende gute Grund als solcher auf ihn ausübt, sein in diesem guten Grund begründetes diesseitig-irdisches Interesse überhaupt festzuhalten.
Nun aber hat die militärisch-soziologischem Fortschritt entsprungene und als Symbiose zwischen armen und reichen Stämmen etablierte neue Gesellschaftsordnung die im Jenseits weilenden wahren Herren des Reichtums um jede sterblich-persönliche Anziehungskraft auf den irdischen Statthalter, um alle tödlich-singularische Faszination für den weltlichen Stellvertreter gebracht und sich in die Gesichtslosigkeit und Anonymität ätherischer Unsterblicher, in die Unverbindlichkeit und Pluralität olympischer Götter zurückziehen lassen. Entbunden von jedem aus der Transzendenz auf ihn einwirkenden lebensgeschichtlichen Wiederholungszwang kann jetzt endlich der Statthalter die ihm eigentlich zugeteilte Aufgabe einer Arretierung des Reichtums im Diesseits erfüllen. Mit der ganzen Resolution des von den Göttern mit aller weltlichen Vollmacht auf sich gestellten theokratischen Herrn kann er endlich der ihm auf Erden aufgetragenen Verwaltung des Reichtums eine uneingeschränkt diesseitige Bedeutung geben, ohne daß ihn die zu ätherischen Unsterblichen anonymisierten jenseitig wahren Herren des Reichtums von diesem Geschäft einer weltlich orientierten Überflußverwendung, das er als theokratischer Herr betreibt, irgend abhalten könnten. So sehr indes die zur Anonymität von Unsterblichen verblaßte jenseitige Macht, die zur Pluralität von Göttern entrückte transzendente Herrschaft, ihr Vermögen verliert, den Priesterkönig in der Ausübung seines irdischen Amts zu stören und von der Verfolgung seines weltlichen Geschäfts abzulenken, so sehr büßt sie zugleich auch die Fähigkeit ein, für seine priesterkönigliche Amtsausübung den guten Grund zu liefern und seiner theokratischen Geschäftigkeit die einsehbare Notwendigkeit zu verleihen. Indem es der prokuristischen Reichtumpflege des Priesterkönigs gelingt, das Interesse des Diesseits gegenüber dem Anspruch des Jenseits effektiv zum Tragen zu bringen, geht ja offenbar der jenseitige Anspruch aller empirischen Realität und materialen Evidenz verlustig, die er im jenseitsfixierten Tun des autochthonen Statthalters bis dahin noch hatte. Durch keinerlei genealogische Affinität mehr substantiiert, verliert sich das Anrecht der transzendenten Herrschaft auf den Überfluß zu einem rein nominalen Besitztitel, dessen reale Ausfüllung und materiale Wahrnehmung ganz und gar der Prokura des Priesterkönigs obliegt. Was mithin vom plutonisch-transzendenten Zugriff auf den Überfluß übrig bleibt, ist eine Möglichkeit, deren Wirklichkeit umfangsgleich mit dem prokuristisch-diesseitigen Tun des Priesterkönigs ist, eine Virtualität, deren Aktualität im bevollmächtigt-immanenten Treiben des theokratischen Herrn aufgeht, ist ein Ansichsein, dessen formale Anerkennung durch den Priesterkönig gleichbedeutend ist mit der Selbstbestätigung des letzteren in seinem qua Überflußpflege realen Fürsichsein, eine Herrlichkeit, deren nominale Anrufung durch den theokratischen Herrn de facto übereinstimmt mit einer Berufung des letzteren auf seine qua Überflußverwaltung materiale Selbstherrlichkeit. So aber uno actu der priesterköniglichen Anerkennung ebensowohl seines bedeutungslosen Formalismus überführt und in seinem nichtssagenden Nominalismus aufgedeckt, gerät jener nominale Titel auf den Überfluß mitsamt seinen göttlichen Trägern hinter der überwältigenden Empirie der vom Priesterkönig realiter ausgeübten Macht und Verfügung über den Reichtum schließlich der Gesellschaft aus dem Blickfeld, schwindet ihr aus dem Gedächtnis. Konfrontiert mit einer Prokura, die so unbeschränkt durch alle realiter reziproke Verpflichtung gegenüber den unsterblichen Verleihern, so frei von jeder den göttlichen Bevollmächtigern geschuldeten resultativen Rechenschaftslegung ist, daß in der Tat die Anerkennung des Anspruchs der letzteren jeglichen empirischen Sinn einbüßt und zur gegenstandslos leeren Geste verkommt beziehungsweise auf einen Akt schierer priesterköniglicher Selbstermächtigung hinausläuft, verliert die Gesellschaft die Stellvertretungsfunktion des theokratischen Herrn überhaupt aus dem Auge und nimmt in seiner Macht über den gesellschaftlichen Reichtum am Ende nichts mehr wahr als – wie oben formuliert – das datum nudum einer aller Legitimation überhobenen selbstherrlich-existentialen Gewalt, das factum brutum einer von Natur gegebenen eigenmächtig-totalen Herrschaft.
Und angesichts solcher nach Maßgabe ihrer Statusquo-Faktizität und Naturgegebenheit grundlosen Verfügung des theokratischen Herrn über den Überfluß wird diese Gesellschaft von den gleichen gemischten Gefühlen hoffnungsträchtiger Mißgunst und erwartungsschwerer Feindseligkeit befallen, wie sie vormals der Stammesgemeinschaft das zur rücksichtslos stetigen Institution gewordene Reichtumsprärogativ des anderen Subjekts einflößte. Ihr, die keiner einsehbaren Notwendigkeit für die Abtretung des Reichtums an den seine nominelle Statthalterschaft hinter reeller Selbstherrlichkeit verschwinden lassenden Priesterkönig mehr ansichtig ist, will dessen Prokura über den Reichtum nun geradeso wie einst der Stammesgemeinschaft das Prärogativ des anderen Subjekts als Ausdruck einer sie, die tatsächliche Produzentin des Reichtums, um die Früchte ihrer Arbeit bringenden grundlosen Usurpation erscheinen. Ganz ebenso wie damals der mythologischen Stammesgemeinschaft die als zweckfrei feste Einrichtung etablierte Reichtumexistenz des anderen Subjekts, sein als sinnferne Dauerfunktion installiertes Leben im Überfluß, stellt sich jetzt auch ihr, der aus der Stammesgemeinschaft neu entstandenen theokratischen Gesellschaft, die als grundlose Naturgegebenheit sich ihr präsentierende Macht des Priesterkönigs über den Reichtum als ein Beschwernis und Ärgernis dar, in dem sie nichts mehr als einen Beweis ihrer eigenen, usurpativ-mutwilligen Diskriminierung und expropriativ-skandalösen Benachteiligung zu sehen vermag. Und ganz genauso wie vormals für jene müssen sich jetzt auch für sie an den Gedanken einer egal ob passiv erlebten Erledigung oder aktiv bewirkten Beseitigung dieses Ärgernisses hochfliegende Hoffnungen knüpfen und verspricht sie sich davon nichts geringeres als eine ihr, der diskriminierten Produzentin, sich eröffnende ungehinderte Existenz im freigesetzten Reichtum, ein ihr, der expropriierten Erzeugerin, blühendes unbeschwertes Leben im ad libitum verfügbaren Überfluß. Weil in völliger Parallelität zu dem, was damals der Stammesgemeinschaft mit dem Prärogativ des anderen Subjekts widerfuhr, die Gesellschaft in der theokratischen Vollmacht nichts mehr zu erblicken vermag als eine – dem fehlenden guten Grund nach zu urteilen – willkürlich gesetzte Widrigkeit, die ihr die Aneignung ihres mit eigener Hand produzierten Reichtums verwehrt, ein – dem Mangel an einsehbarer Notwendigkeit zufolge – zufällig aufgetauchtes Hindernis, das sie vom Genuß ihres selbsterzeugten Überflusses abhält, kann sie wie jene gar nicht umhin, mit dem Gedanken an ein Verschwinden jener grundlosen Widrigkeit die Hoffnung auf einen ihr selber dadurch sich bietenden ungehinderten Zugang zum Reichtum und Umgang mit dem Überfluß zu verbinden.
Anders allerdings als einst bei der mythologischen Gemeinschaft und im wesentlichen Unterschied zu damals gehen bei der theokratischen Gesellschaft diese durch die Situation zwangsläufig geweckten mißgünstigen Hoffnungen ebenso zwangsläufig einher mit der Erinnerung an eine ihre Eitelkeit bezeugende Erfahrung – der Erinnerung an die schreckliche Erfahrung nämlich, die vormals die mythologische Gemeinschaft machen mußte, als es zu guter Letzt zur erhofften Erledigung jenes widrigen Beschwernisses wirklich kam und das von ihr sei's bloß mit passiver Mißgunst beobachtete, sei's mehr noch mit aktiver Feindseligkeit bedachte andere Subjekt seine grundlos bevorzugte Existenz im Reichtum fahrenließ und mit Tode abging. Weit entfernt davon, daß damals der von seinem Usurpator befreite Reichtum sich den Stammessubjekten als ihr natürliches Hab und Gut zu eigen gegeben hätte, verwandelte er sich vielmehr – jenem ursprünglich ex improviso seiner selbst erschienenen Usurpator unverbrüchlich ergeben und über den Tod hinaus treu – vor den Augen der mythologischen Gemeinschaft in ein reminiszierendes Mahnmal des Verschiedenen, ein remonstratives Memento des Toten, das den letzteren an die unbedingte Indifferenz einer das Stammesdiesseits mitsamt dem ganzen Reichtum als in toto irrealisiert zurücklassenden ursprünglichen Jenseitigkeit verloren zeigte und das auf diese Weise die Stammesgemeinschaft zu dem als Totenkult geschilderten Versuch zwang, mit dem Reichtum als Bindeglied und Integrationsfaktor solche verheerend anteriorische Jenseitigkeit des Verschiedenen ihrer alles entwertenden Negativität zu entkleiden und in eine als unterirdisch-chthonischer Bereich firmierende spezifische Differenz zum irdischen Diesseits, eine als totenweltlich-plutonische Sphäre subsistierende bestimmte Negation zur weltlichen Immanenz zurückzuversetzen. Statt über den Reichtum endlich, wie erhofft, ungehindert und im eigenen Sinne verfügen zu können, mußten die Stammessubjekte ihn vielmehr sofort wieder drangeben, um mit seinen Mitteln dem als der wahre Herr des Reichtums in Gewahrsam genommenen Verschiedenen den Heimgang in ein ontologisch dem Stammesdasein entzogenes anteriorisches Sein zu verbauen und die goldenen Fesseln einer ans irdische Diesseits räumlich angrenzenden unterirdisch-jenseitigen, plutonischen Existenz anzulegen, ihm die Rückkehr in einen modallogisch dem Stammesprozeß entrückten apriorischen Anfang zu verwehren und den fürstlichen Aufenthalt einer an die weltliche Immanenz topisch anschließenden totenkultlich-transzendenten, thesaurischen Residenz anzuweisen. Statt des Reichtums, den sie hervorbrachten, sich endlich nach Belieben bedienen zu können, mußten die Stammessubjekte ihn vielmehr ebenso fruchtlos wie ausnahmslos und ebenso unabsehbar wie unaufhörlich zur Identifizierung und Integration jenes Toten verwenden, von dessen Tod sie sich doch gerade einen ungehindert eigenen Umgang mit dem Reichtum und einen ungestört persönlichen Gebrauch des Überflusses versprachen.
Und diese gleiche sterbensbittere Erfahrung einer wegen der reminiszierenden Kraft, die der Reichtum im Gewahrsam des Verschiedenen an den Tag legt, chthonisch-katabolisch entfremdeten Reichtumsverwaltung und totenkultlich verkehrten Überflußverwendung droht nun erneut – droht jetzt der neuentstandenen Gesellschaft von ihrem eine materialiter bedingungslose Verfügung über den Überfluß behauptenden theokratischen Herrn, sobald dieser der sei's heimlichen Mißgunst, sei's offenen Feindseligkeit, mit der die Gesellschaft ihm sei's abwartend gegenübersteht, sei's zupackend begegnet, weicht und aus dem Leben scheidet. So wahr die allem Anschein nach willkürlich-usurpatorische Macht und ungerechtfertigt-expropriative Verfügung über den Reichtum, die der seine nominellen Prokurageber hinter der Realität seiner Machtausübung aus dem Blickfeld rückende Priesterkönig behauptet, in der theokratischen Gesellschaft die gleichen mißgünstigen Hoffnungen erregt, mit denen weiland der Anblick der allem Anschein nach unbegründeten Prärogative des anderen Subjekts die mythologische Stammesgemeinschaft erfüllte, so wahr steht der theokratischen Gesellschaft das gleiche böse Erwachen aus all ihren Hoffnungen bevor, das bereits der mythologischen Stammesgemeinschaft beschieden war. Indes steht ihr dieses bittere Ende ihrer Hoffnungen nicht nur bevor, sondern eben dank der Tatsache, daß es sich dabei um eine bloße Wiederholung dessen handelt, was bereits der mythologischen Stammesgemeinschaft beschieden war, weiß und antizipiert sie auch, was ihr bevorsteht. Und dieses Wissen, diese Antizipation des Kommenden erzeugt in der theokratischen Gesellschaft notwendig einen gegenläufigen Affekt angstvoller Unlust und panischer Abwehr, der der Emotion hoffnungsvoller Mißgunst und erwartunssschwangerer Feindseligkeit, mit der das Gegenwärtige sie erfüllt, ineins den Prozeß und den Garaus macht. Kaum daß die theokratische Gesellschaft, provoziert durch die, wie ihr scheinen will, ungerechtfertigte Verfügungsgewalt ihres priesterköniglichen Herrn, auf dessen endliche Entfernung oder auch schließliche Beseitigung zu hoffen und von einer ungehindert eigenen Existenz im Reichtum zu träumen beginnt, läßt sie die simultan sich einstellende Erinnerung an das, was unter den gleichen Umständen der Stammesgemeinschaft widerfuhr, die Erinnerung nämlich daran, daß dort die erhoffte eigene Existenz im Reichtum der chthonisch-katabolischen Konfiskation des Reichtums durch den ins Jenseits Verschiedenen zum Opfer fiel, aus ihren Träumereien auch schon wieder aufschrecken und auf nichts weiter mehr aus sein als auf die Abwendung jenes das irdische Diesseits in eine Maschine zur Befriedigung der Bedürfnisse des chthonischen Jenseits umfunktionierenden Konfiskationsverfahrens, auf nichts sonst mehr bedacht sein als auf die Vermeidung jenes die empirische Immanenz in einen Zuliefererbetrieb für die plutonische Transzendenz pervertierenden Requisitionsvorgang. Im erinnerungsträchtig vollen Bewußtsein ihrer Bedrohung durch eine aller Voraussicht nach haargenaue Wiederholung jenes chthonisch-katabolisch bitteren Endes, das in der gleichen Situation die mythologische Stammesgemeinschaft ereilte, läßt die theokratische Gesellschaft alle in eben dieser Voraussicht als eitel entlarvten Hoffnungen fahren und sucht allein noch nach einem Ausweg, jenem bitteren Ende eines zur jenseitsorientiert bodenlosen Reichtumskatabole verurteilten Lebens für den Toten zu entrinnen.
Das Mittel, dem Priesterkönig seine Legitimation zu erhalten, findet die theokratische Gesellschaft im Opfer, darin, daß sie dem Priesterkönig eine in Reichtumsgaben sich manifestierende materiale Anerkennung des formalen Eigentumsanspruchs der Götter abnötigt. Dabei benutzt sie als Druckmittel ihre zum Neid der Götter hypostasierte Mißgunst gegen ihn, die sie ihm warnend vorhält und mit der sie ihm Angst vor seiner eigenen, zur Hybris erklärten Machtfülle einjagt.
Wo sonst aber soll sie diesen Ausweg auftun, wenn nicht bei denen, die als die Geber seiner Vollmacht immerhin ja eine nominelle Dominanz und formelle Kontrolle über den Priesterkönig in Anspruch nehmen können und die nur leider dessen realiter unbedingte irdische Machtausübung ihr, der Gesellschaft, hat aus den Augen geraten und aus dem Gedächtnis schwinden lassen – bei den ätherischen Unsterblichen nämlich, den olympischen Göttern. In der Tat ist es die formell verpflichtende transzendente Existenz der letzteren, die, wie oben ausgeführt, den zu Lebzeiten mit unbedingter irdischer Prokura über den Reichtum ausgestatteten theokratischen Herrn im Todesfall daran hindert, seiner im Diesseits bedingungslosen Macht über den Reichtum kraft der Drohung, sie in jenseitig unbedingte Indifferenz gegen die gesamte Reichtumsphäre, in transzendent absolute Negativität gegenüber der ganzen Welt des Überflussses umschlagen zu lassen, erneut die aus Stammesgemeinschaftszeiten erinnerliche Bedeutung eines aus dem unterweltlichen Jenseits heraus sich realisierenden chthonisch-plutonischen Anspruchs zu verschaffen. Als selber der Unterwelt entstammende, dem Totenreich entstiegene und aber dank militärtechnisch-soziologischen Fortschritts zur Anonymität und Pluralität einer ätherischen Jenseitigkeit entrückte wahre Herren des Reichtums sind sie es, die Götter, die, wie sie einerseits anonym und vielgestaltig den alten Totenkult, dem sie selber entspringen, als unwiederbringlich Vergangenes ad acta legen, so andererseits jeder beim Verscheiden ihres priesterköniglichen Statthalters auf Erden möglichen unveränderten Neuauflage des alten Totenkults entgegenstehen. Sie, die wahren Eigner des Überflusses, sind es, die durch ihren auf den Reichtum gemünzten nominalen Besitzanspruch und formalen Eigentumsvorbehalt der theokratischen Gesellschaft beim Abgang des Priesterkönigs gestatten, den Verschiedenen mit den pompes funèbres eines Leichenbegängnisses abzufertigen, den Toten mit dem verschwenderischen Aufwand eines Totenmahls abzuspeisen und ihn hiernach vor die in Wirklichkeit ebenso egale, wie dem Schein nach kruzifikatorische Alternative zu stellen, ob er lieber in seinem Grab zur letzten Ruhe gebettet und ewigem Vergessen überantwortet sein oder aber allen totenkultlichen Konnotationen entsagen und Aufnahme in die Anonymität und Pluralität der ätherisch-olympischen Sphäre finden will. Und offenbar ist es ja auch nichts sonst als das Verschwinden dieser jenseitig wahren Herren des Reichtums aus dem Gesichtskreis priesterköniglicher Machtausübung, ist es also nichts weiter als eben der Umstand, daß hinter der realiter unbedingten Prokura ihres Statthalters auf Erden sie, die Unsterblichen, der Wahrnehmung der theokratischen Gesellschaft kurzerhand entschwinden, was den Priesterkönig in jene Position einer in völliger Naturgegebenheit willkürlich-usurpatorischen Macht über den Reichtum und in voller Selbstherrlichkeit unlegitimiert-expropriativen Verfügung über den Überfluß versetzt, die die Gesellschaft situativ zwar und im Zeichen einer suggestiven Empirie mit der mißgünstigen Hoffnung auf einen nach dem Tode des Usurpators ungehinderten Zugriff auf den Überfluß erfüllen, objektiv aber und im Kriterium der historischen Erfahrung mit dem schicksalsschweren Schreckensbild einer durch solchen Todesfall zwangsläufig vielmehr heraufbeschworenen unveränderten Wiederauflage des alten, aus Stammesgemeinschaftszeiten erinnerlichen Totenkults konfrontieren muß. So gewiß es die ätherische Existenz dieser pro nomine wahren Herren des Reichtums, die olympische Anwesenheit dieser pro forma wirklichen Überflußeigner ist, was der Gesellschaft die Handhabe gibt, dem theokratischen Überflußverweser nach seinem Tode alles von einem transzendenten Totenreich her behauptete fortgesetzte Anrecht auf den diesseitigen Überfluß zu verweisen, so gewiß ist es umgekehrt die durch die materiale Verfügungsgewalt des theokratischen Herrn herbeigeführte Abwesenheit dieser olympisch-formalen Überflußeigner, die – allen dadurch in der Gesellschaft erregten Vorstellungen vom unnotwendig-usurpatorischen Charakter des priesterköniglichen Machthabers zum Trotz und allen zu Lebheiten des letzteren deshalb in ihr erweckten Hoffnungen auf ein mit seinem Tode ihr selber möglich werdendes ungestörtes Sein im Reichtum zum Tort – dem verschiedenen Reichtumsverwalter vielmehr die Gelegenheit verschafft, jenen jenseitig-chthonischen Aspruch auf den diesseitigen Reichtum mit dem alten katabolisch-thesaurischen Nachdruck erneut zur Geltung zu bringen.
Was liegt unter solchen Umständen für die Gesellschaft näher, als sich zur Verhinderung jener vom priesterköniglichen Postmortem drohenden Wiederauflage der früheren unheilig-heiligen Katabole, zur Verhütung jener im theokratischen Todesfall zu gewärtigenden Neuausgabe des alten abgründigen Totenkults um eine Rückführung dieser aus dem Blickfeld geratenen ätherisch-wahren Reichtumbesitzer in die Präsenz priesterköniglicher Machtausübung, eine Wiedereingliederung dieser dem Gedächtnis entfallenen olympisch-wirklichen Überflußeigner in die Observanz theokratischer Verfügungsgewalt zu bemühen? Konfrontiert mit dem bitteren Ende eines mangels Besitzanspruchs durch die Unsterblichen vom verschiedenen Priesterkönig abermals geltend gemachten chthonisch-plutonischen Anspruchs auf den Reichtum, besinnt sich die Gesellschaft auf eben diese Unsterblichen und ihren nominalen Besitzanspruch als auf das einzige Mittel, solchem bitteren Ende zu wehren. Gegen alle von der Realität der irdischen Machtausübung des Priesterkönigs, von der Materialität der weltlichen Verfügungsgewalt des theokratischen Herrn ausgehende suggestive Amnesie entschließt sich die Gesellschaft, aufgeschreckt durch die erinnernde Vorwegnahme des der Amnesie auf dem Fuße folgenden bösen Erwachens, zur Anamnesis und richtet ihren Sinn auf diese ätherischen Unsterblichen, deren in jenseitiger Existenz unvermittelte Gegenwart und unverbrüchliche Anwesenheit sie behauptet und deren neuerlich erklärte Anerkennung in ihrer Rolle als prokuraverleihend wahre Herren des Reichtums sie, die Fürsprecherin dieser Unsterblichen, vom Priesterkönig fordert, deren abermals ausgesprochene Bestätigung in ihrer Eigenschaft als vollmachtgebend wirkliche Überflußeigner sie, die Sachwalterin dieser Götter, vom theokratischen Herrn verlangt.
Die Gesellschaft weiß indes, daß es, um die Götter zur dauerhaft jenseitigen Gegenwart im Wahrnehmungsbereich priesterköniglich diesseitiger Machtausübung über den Reichtum, zur bleibend transzendenten Anwesenheit in der Observanz theokratisch immanenter Verfügungsgewalt über den Überfluß zu bewegen, mehr braucht als eine einfache Wiederholung jener nominellen Anerkennung, die der Priesterkönig ihnen als den wahren Reichtumbesitzern vorher gezollt hat. Will die Gesellschaft die ätherischen Unsterblichen als transzendent präsente Instanz ernsthaft zurückgewinnen, um mit ihrer Hilfe den weltlichen Überflußverweser teils zu Lebzeiten vor gesellschaftlichem Neid und Groll zu bewahren, teils nach seinem Tode vom drohenden Rückfall ins frühere totenkultliche Unwesen abzuhalten, so muß sie den letzteren dazu bringen, daß er mehr tut, als den ersteren bloß ihren alten, unverbindlich nominalen Besitzanspruch auf den Reichtum wieder zu konzedieren. Diesen Anspruch hat der Priesterkönig den Göttern ja auch niemals bestritten. Daß sie die pro nomine wahren Herren des Reichtums, die pro titulo wirklichen Überflußeigner seien, hat er niemals in Abrede gestellt. Aber was mit solch nomineller Anerkennung ihres Besitzanspruchs passiert, ist, daß diese angesichts der von Verpflichtung freien realen Machtfülle und materialen Verfügungsgewalt der dem Priesterkönig verliehenen Prokura über den Reichtum dem Nominalismus einer einfachen Reaffirmation dessen, was auf Erden der Fall ist, verfällt und sich als flatus voci, als nichtssagende Floskel, enthüllt, daß sie zum Formalismus einer schieren Sanktionierung des weltlichen Statusquo verkommt und als leere Geste, als bedeutungslose Formalie, dasteht. Und was in der Konsequenz dieser Nominalisierung des priesterköniglichen Anerkennungsakts zur entbehrlichen Floskel, dieser Formalisierung der theokratischen Bestätigungsprozedur zur überflüssigen Formalie geschieht, ist, daß mit all den bedrohlichen Implikationen, um deren Bewältigung beziehungsweise Verhinderung die Gesellschaft sich nun als Fürsprecherin der Götter bemüht, jener Besitzanspruch mitsamt den nominell als wahre Herren des Reichtums anerkannten Unsterblichen, die ihn erheben, hinter der Realität der Machtausübung des irdischen Reichtumsverwalters der theokratischen Gesellschaft überhaupt aus dem Blickfeld gerät. Warum sollte wohl eine Wiederholung der gleichen formellen Bestätigungsprozedur erfolgreicher sein als vorher und nämlich mehr erbringen als nur noch einmal teils die Entlarvung der Bestätigung selbst als gegenstandsloser Geste und sinnloser Formalie, teils damit die Überführung der formaliter als Geber der Vollmacht des theokratischen Herrn Bestätigten in realiter durch die priesterkönigliche Machtfülle Ausgeschlossene, materialiter hinter der theokratischen Verfügungsgewalt Verschwundene?
Will also die theokratische Gesellschaft mehr erreichen als bloß eine Wiederholung dieses Ergebnisses einer haltlosen Eskamotierung des formalen Eigentumsvorbehalts der Götter durch die reale Eigenmacht und materiale Selbstherrlichkeit des Priesterkönigs und will sie vielmehr jenem Eigentumstitel mitsamt seinen göttlichen Trägern selbst eine in actu aller irdischen Machtausübung handgreiflich dauernde Geltung verschaffen und eine in specie jeder weltlichen Verfügungsgewalt sinnenfällig bleibende Bedeutung sichern, so muß sie den Priesterkönig dazu bringen, daß er jenes Anrecht der Götter in einer Form Bestätigung finden läßt, die es an realer Relevanz mit dem Modus der priesterköniglich eigenen Macht über den Reichtum aufnehmen, sich in bezug auf materiale Evidenz dem Duktus der vom theokratischen Herrn selbst behaupteten Verfügung über den Überfluß an die Seite stellen kann. Wenn die theokratische Gesellschaft erreichen möchte, daß in irdischen Reichtumsdingen die ins Jenseits entrückten Unsterblichen eine bei aller Jenseitigkeit sich als unverbrüchlich diesseitig bewährende herrschaftliche Insistenz behaupten, so muß sie dafür sorgen, daß der Priesterkönig diesen von ihm als wahre Herren des Reichtums anerkannnten Göttern kraft Anerkennungsakt einen Zugang zum Reichtum eröffnet, dessen empirische Realität und materiale Faktizität hinter der des priesterköniglichen Umgangs mit dem Reichtum nicht zurücksteht und der eben deshalb auch nicht Gefahr läuft, unter dem Eindruck des letzteren zu nichts zu verschwinden und in Vergessenheit zu fallen. Nicht also bloß den ganzen Reichtum, den gesamten Überfluß formell und symbolisch, sondern ihn pars pro toto reell und empirisch muß der theokratische Herr seinen unsterblichen Auftraggebern und göttlichen Vollmachtverleihern zuerkennen und offerieren. Und nicht bloß pro nomine und andächtig spirituell, sondern per officium und sinnenfällig-institutionell muß er durch dieses Zugeständnis, diese Offerte, dieses Opfer, die Götter als die wirklichen Überflußeigner Gegenwart und Geltung gewinnen lassen.
Bleibt allerdings die Frage, wie die Gesellschaft den Priesterkönig zu diesem realen Zugeständnis, dieser materialen Offerte, diesem handgreiflich-sinnenfälligen Opfer bringen und wie sie den theokratischen Herrn nämlich dazu bewegen kann, die Abwesenheit der durch eine bloß formelle Bestätigung in Vergessenheit gestürzten wirklichen Überflußeigner als eine nicht nur für sie, die theokratische Gesellschaft, sondern auch und gerade für ihn, den Theokraten selbst, bedrohliche Defizienz wahrzunehmen. In der Tat vermag ja der Priesterkönig in jener chthonisch-plutonischen Resurrektion, die das Verschwinden der Unsterblichen ihm als Postmortem verheißt, eine Gefahr für die eigene Person unmittelbar gar nicht zu erkennen. Jene im Todesfall zu gewärtigende unveränderte Wiederauflage des alten Totenkults, die für die theokratische Gesellschaft nichts geringeres darstellt als die furchtbare Bedrohung einer ad infinitum katabolisch entfremdeten Reichtumproduktion und pro nihilo thesaurisch selbstvergessenen Überflußerzeugung, beinhaltet ja für ihn, den Theokraten selbst, unmittelbar nur den der Selbstherrlichkeit förderlichen Prospekt und die der persönlichen Eitelkeit schmeichelnde Perspektive eines bis hinein in die jenseitige Verschiedenheit durchgesetzten herrschaftlichen Seins im Reichtum. Mag deshalb die Gesellschaft den Priesterkönig noch so sehr vor jenem aus der Verdrängung der Unsterblichen und ihres Anspruchs auf den Reichtum konsequierenden chthonisch-plutonischen Prospekt warnen, mag sie ihm jenen Prospekt noch so sehr als die Frucht einer die Domäne der wahren Herren des Reichtums verletzenden frevelhaften Anmaßung, als die Ausgeburt eines gegen die Gerechtsame der wirklichen Überflußeigner sich vergehenden sträflichen Begehrens vorhalten, mag sie ihm die plutonisch-jenseitige Macht über den Reichtum, der er kraft irdischer Eigenmächtigkeit entgegenstrebt, noch so sehr als das chthonische Vexierbild eines den Unsterblichen entrissenen und entgegen seiner Bestimmung sterblichem Streben dienstbar gemachten ätherischen Privilegs, als den katabolischen Wechselbalg eines den Göttern gestohlenen und im Widerspruch zu seinem Wesen durch Menschensinn entstellten olympischen Titels, mithin als Ausdruck bedenkenlosesten Übermuts, als Zeichen unbesonnenster Hybris verweisen – die Lust, es mit jener in Abwesenheit der Götter ihm sich eröffnenden Aussicht auf eine plutonische Quasi-Unsterblichkeit, eine thesaurisch eigene Art Göttlichkeit, zu versuchen, können ihm solche Vorhaltungen und Verweise allein schwerlich vergällen. Damit dem Priesterkönig diese hybride Lust, sich das Verschwinden der Unsterblichen zur postmortem eigenen Immortalisierung dienen zu lassen, diese übermütige Bereitschaft, sich die Abwesenheit der Götter zur plutonisch persönlichen Vergöttlichung zunutze zu machen, vergeht, muß vielmehr die theokratische Gesellschaft den anderen mit der Absenz der Götter verknüpften Effekt ins Spiel bringen, daß solche Absenz neben der glänzenden Aussicht, die sie dem Priesterkönig eröffnet, auch eine bedrohliche Mißgunst ihm gegenüber wachruft und eine gefährliche Feindseligkeit gegen ihn erregt. Sie muß ihm, mit anderen Worten, klar machen, daß jene köstlichen Aussichten im Jenseits, die ihm die Abwesenheit der Götter erschließt, einhergehen mit einer bedrohlichen Erschütterung seiner Stellung im Diesseits und daß er in der Tat Gefahr läuft, das in Aussicht genommene zeitlos chthonische Sein mit einem vorzeitigen Ende seines irdischen Daseins zu bezahlen, die wahrgenommene Chance einer wundersam posthumen Existenz mit einem gewaltsamen Abbruch seines derzeitigen Lebens zu büßen.
Dieser zweite Aspekt, den die Absenz der Götter hervorkehrt: daß sie dem Priesterkönig nämlich nicht nur jene totenkultliche Perspektive eröffnet, sondern ihn zugleich auch durch die Feindseligkeit, die sie gegen seinen lebensweltlichen Status erweckt, früher, als ihm lieb sein kann, in jene totenkultliche Perspektive hineinzustoßen und mit ihr zu vermählen droht – dieser zweite Aspekt ist in der Tat dazu angetan, den Priesterkönig die Lust an der letzteren verlieren und statt dessen Interesse an der ihm von der theokratischen Gesellschaft zugedachten Aufgabe einer konzessionswillig realen Raffirmation oder opferfreudig materialen Repräsentation der abwesenden Götter selbst gewinnen zu lassen. Mag die Aussicht auf ein plutonisch-ewiges Leben im Totenreich noch so sehr seiner Eitelkeit schmeicheln und ihm noch so verlockend erscheinen – sich um solcher Aussichten willen die irdische Existenz verkürzen und den Faden des weltlichen Lebens vorzeitig abschneiden zu lassen, ist er deshalb noch lange nicht geneigt. Vielmehr läßt sich darauf rechnen, daß er angesichts solcher mit der totenkultlichen Aussicht einhergehenden lebensweltlichen Bedrohung bereit ist, den Warnungen der theokratischen Gesellschaft, die ihm das Verlangen nach chthonischer Unsterblichkeit als strafwürdige Hybris, als frevelhaften Übermut verweist, Gehör zu schenken und im Zuge einer opferfreudig materialen Besinnung auf die Götter die totenkultliche Aussicht auf permanent jenseitige Macht und Fülle dranzugeben, nur um hier die lebensweltliche Bedrohung durch virulent diesseitige Mißgunst und Feindseligkeit loszuwerden. Fragt sich bloß, auf welche Weise die theokratische Gesellschaft dem Priesterkönig diese lebensgefährliche Mißgunst, die in Abwesenheit der Götter gegen ihn wach wird, nahebringen soll. Schließlich ist, wovon sie ihn in Kenntnis setzen muß, tatsächlich ja ihr höchsteigener Animus und Affekt, ist, wovor sie ihn warnen muß, in Wirklichkeit nur die Bedrohung und Gefahr, die von ihr selber, ihrer höchstpersönlichen Einstellung ihm gegenüber ausgeht. Niemand sonst als sie ist es ja, die unter dem Eindruck des mit den Unsterblichen verschwundenen guten Grunds für seine Vollmacht über den Reichtum eben die hoffnungsträchtige Animosität gegen den Priesterkönig entwickelt, die sie ihm jetzt als die unvermeidliche Implikation seines Aufräumens mit den Unsterblichen und Verzichts auf die Götter vor Augen rücken und durch deren Vorweis sie ihn von seiner hybriden Selbstherrlickeit abbringen, von seinem gottlosen Übermut heilen möchte. Kann die theokratische Gesellschaft dem Priesterkönig ihre Feindseligkeit wirklich offen zur Kenntnis bringen, als den ihr eigenen Animus tatsächlich in aller Ehrlichkeit eingestehen? Riskiert sie nicht, wenn sie das tut, einen Vertrauensverlust in den Beziehungen des Priesterkönigs zu ihr, eine Entfremdung, die der Umstand, daß kraft der neuerlichen Anwesenheit der vollmachtgebenden Götter sie, die Gesellschaft, unter die Botmäßigkeit des Priesterkönigs zurückkehrt, in die frühere Untertänigkeit ihm gegenüber zurückversetzt wird, vielleicht zwar überspielen, niemals aber vergessen lassen kann? Läuft sie nicht, wenn sie also verfährt, Gefahr, durch ihre Eröffnungen sein Verhältnis zu ihr derart zu belasten, daß, allem äußeren Anschein einer durch die Rehabilitation der Unsterblichen ermöglichten Restauration der alten Ordnung zum Trotz, der Schaden in der Tat irreparabel und nämlich an eine Wiederherstellung der alten, durch ebenso arglose Treue auf der einen wie bedenkenlosen Glauben an diese Treue auf der anderen Seite bestimmten Herr-Knecht-Beziehung gar nicht mehr zu denken ist?
Und kann sie, recht besehen, auch nur sich selbst gegenüber zu diesem Affekt sich bekennen? Zerstört sie nicht, wenn sie das tut, unwiederbringlich ihr eigenes Äquilibrium und begibt sich auf ewig in eine zur objektiven Schizophrenie geratende Konfrontation mit eben der durch die Abwesenheit der Götter heraufbeschworenen mißgünstig animierten Existenz und feindselig alterierten Verfassung, von der sie doch gerade nichts mehr wissen und kraft der dem Priesterkönig abverlangten erneuten Anwesenheit der Götter partout befreit sein will? Setzt sie nicht, wenn sie, um ihrer Forderung nach materialer Wiedereinsetzung der Götter beim Priesterkönig Gehör zu verschaffen, mit dieser widrigenfalls gefährlich alterierten Verfassung ihrer selbst Politik macht – setzt sie dann nicht wie schon einerseits das mit der Kenntnis dieser Seite ihrer Persönlichkeit ersichtlich unvereinbare alte priesterkönigliche Vertrauensverhältnis zu ihr, so auch andererseits ihr eigenes, sich im Schutz der Götter von dieser Seite ihrer Persönlichkeit zu befreien und in der früheren, unzweideutigen Fassung wiederherzustellen bemühtes Selbstverhältnis aufs Spiel? Wie soll der Priesterkönig jemals in Frieden mit einer Gesellschaft leben können, von der er weiß, daß nur die Anwesenheit der Götter sie zwingt, in Gehorsam ihm gegenüber zu verharren, und sie hindert, in Mißgunst gegen ihn auszubrechen? Und wie soll die Gesellschaft jemals in Eintracht mit sich selber leben können, wenn sie sich solche Eintracht durch das Eingeständnis hat erkaufen müssen, daß dieses ihr Selbst nur in Anwesenheit der Götter es selbst ist und sich in deren Abwesenheit vielmehr in einen Unruhestifter erster Güte und Zwietrachtsäer vor dem Herrn verwandelt?
Ein hoher Preis also, den die theokratische Gesellschaft zahlen muß, wenn sie gezwungen ist, die Rückkehr des Priesterkönigs unter die Oberhoheit der Unsterblichen durch das nach außen offene Eingeständnis und nach innen erklärte Bewußtsein einer widrigenfalls von ihrer, der Gesellschaft, eigenen Korporation oder gar Hand ihm, dem Priesterkönig, entgegenschlagenden existenzbedrohenden Feindseligkeit zu erkaufen! So sehr ihr auf diesem Weg einer reflexiv ebenso wie kommunikativ erstatteten Selbstanzeige gelingen mag, den Priesterkönig zu einer realen Anerkennung der Unsterblichen als der wahren Herren des Reichtums, mithin aber zu einer Wiederherstellung der alten, vor jedem chthonisch-plutonisch bösen Erwachen Schutz gewährenden Ordnung zu bewegen – dadurch, daß sie, um dies zu erreichen, bereit sein muß, aus ihrem Herzen keine Mördergrube zu machen und sich zu eben dem Affekt öffentlich zu bekennen, den mitsamt seinen bösen Folgen und seinem bitteren Nachspiel sie doch gerade verhüten will, führt sie in die wiederhergestellte Ordnung ein Bewußtsein der permanenten Doppelbödigkeit oder latenten Ambivalenz ein, das die Beziehungen des Priesterkönigs zu ihr wie auch ihr Selbstverhältnis irreparabel unterminieren muß. Zwar, um das Schlimmste, den Rückfall nämlich in einen neuen Totenkult, zu verhindern, kann der theokratischen Gesellschaft kein Preis zu hoch sein und wird sie also auch notfalls solche Selbstanzeige in Kauf nehmen. Aber falls sich ihr eine Alternative bietet, die ihr die Selbstanzeige erspart, während sie beim Priesterkönig den gleichen Effekt wie die letztere erzielt, wird sie diesem alternativen Verfahren selbstverständlich den Vorzug geben. Diese Verfahrensalternative, die sie in der Tat findet, besteht darin, daß sie ihre Animosität gegen den Priesterkönig zu einem bloß integrierenden Bestandteil und rein faktorellen Moment eben des priesterköniglichen Verhältnisses zu den Göttern funktionalisiert, dessen Verlust jenen Animus auf den Plan ruft und dessen Rückgewinnung ihn wieder zum Verschwinden bringen soll. Das heißt, die theokratische Gesellschaft entzieht sich der Selbstanzeige dadurch, daß sie den ihr eigenen Affekt von seiner gesellschaftlichen Basis und Subjektgrundlage abstrahiert, um ihn nurmehr als abhängigen Ausdruck eines fehlenden Verhältnisses des Priesterkönigs zu den Unsterblichen wahrzunehmen, ihn bloß noch als variable Funktion des Herausfallens der Götter aus der priesterköniglichen Observanz zu begreifen. Indem so aber die Mißgunst von ihrem qua theokratische Gesellschaft eigentlichen Träger abgelöst und als strikt relative Funktion jener göttlichen Mächte aufgefaßt wird, deren Verschwinden sie heraufbeschwört und deren Wiederkehr von ihr heilen soll, verwandelt sie sich in ein freiflottierendes Quantum Animosität, das mangels eigenem Subjekt sich den göttlichen Mächten selbst assoziiert, um fortan als deren eigene, durch reine Entfernung erregte Gemütsstimmung und durch schiere Abwesenheit ins Leben gerufene Geistesverfassung in Erscheinung zu treten. Als Animus, der sich per definitionem des Verschwindens der Unsterblichen aus der priesterköniglichen Observanz automatisch entwickelt, als Affekt, der sich in absentia der vom theokratischen Herrn verdrängten Götter spontan einstellt, sucht und findet jene von ihrer Subjektgrundlage abgelöste Mißgunst in den abwesenden Göttern selbst ihren neuen subjektiven Grund und nimmt als der vielberufene Neid der Unsterblichen, der sprichwörtliche Groll der Götter Gestalt an.
Eben dies allerdings, wie jene in den Neid distanter Unsterblicher überführte Animosität tatsächlich Gestalt annehmen soll, bleibt ein Problem. Daß die theokratische Gesellschaft ihre eigene Mißgunst gegen den die Götter vernachlässigenden Priesterkönig in einen reinen Funktionsausdruck und eine bloße Zustandsbestimmung der vom Priesterkönig vernachlässigten Götter selbst transformiert, hat nämlich neben dem unbestreitbaren Vorteil, daß sie sich dadurch die Selbstanzeige, die Aufdeckung ihres zur Mördergrube verkniffenen Herzens erspart, auch den ebenso unbezweifelbaren Nachteil, daß sie damit jenen Affekt all seiner empirischen Evidenz und Überzeugungskraft beraubt. Als das den Unsterblichen nach Maßgabe ihrer Verdrängung nachgesagte Ressentiment, die den Göttern im Zeichen ihrer Mißachtung zugeschriebene Ranküne verflüchtigt sich jener Affekt zu einer gestaltlosen Gefahr und unbestimmten Bedrohung, die, auch wenn sie den Priesterkönig mit vager Furcht erfüllen mag, doch kaum geeignet ist, ihm den Eindruck einer lebensgefährlichen und eben darum auf sofortige Maßnahmen dringenden Aggressivität zu vermitteln. Um die Gefahr von dieser Gestaltlosigkeit und Unbestimmtheit zu befreien und ihr in den Augen des Priesterkönigs Virulenz zu verleihen, muß die theokratische Gesellschaft ihr auf synthetischem Wege etwas von jener empirischen Sinnenfälligkeit und praktischen Eindrücklichkeit nachweisen, die sie natürlicherweise hätte, wenn sie ihr, der Gesellschaft, als die ihr eigene Mißgunst ins Gesicht geschrieben stünde und als ihre höchsterpsönliche Feindseligkeit von der Stirn abzulesen wäre. Die theokratische Gesellschaft erbringt diesen Nachweis der Sinnenfälligkeit des den Unsterblichen nachgesagten Ressentiments, indem sie Zeichen des Ressentiments in der Physiognomie des Kosmos entdeckt, seine Äußerungen auf dem Antlitz der natürlichen und kultürlichen Umwelt ausfindig macht. Keine außergewöhnliche Himmelserscheinung, keine Unregelmäßigkeit im Ablauf der Jahreszeiten, kein Erdbeben, Hagelsturm oder Unwetter, keine Flut- und Dürrekatastrophe, keine Erkrankung des Viehs, keine Mißgeburt, keine Aggressionshandlung der Nachbarn, kein Vertragsbruch der Verbündeten, keine schlechte Nachricht von draußen, kein Stolpern des priesterköniglichen Herrn auf der Treppe, kein Todesfall in seiner Familie, kein Sprachlapsus bei der Verkündigung eines Befehls, kein Haar in seiner Suppe – kein Ereignis, das nicht der theokratischen Gesellschaft dazu diente, es dem von seiner realen Vollmacht über den Reichtum zur Hybris einsamer Größe verführten, von seiner materialen Verfügungsgewalt über den Überfluß zum Übermut selbstherrlichen Bestehens disponierten Priesterkönig als redenden Beweis für den animosen Affekt der als die wahren Herren des Reichtums hinter solch einsamer Größe zum Verschwinden gebrachten Unsterblichen warnend vorzuhalten, als schlagenden Beleg für das aggressive Ressentiment der als die wirklichen Überflußeigner durch solch selbstherrliches Bestehen verdrängten Götter verweisend darzubieten. Indem so aber der Priesterkönig sich mit dem Neid der distanzierten Unsterblichen in der Form von tausenderlei natürlichen und kultürlichen An- und Vorzeichen, von zahllosen unheilvollen Omen und schicksalsschweren Orakeln sinnenfällig konfrontiert und spürbar bedrängt findet, kann er gar nicht umhin, die virulente Bedrohlichkeit jenes von allen Palastwänden abzulesenden Neids der Unsterblichen als gegeben zu akzeptieren, die imminente Gefährlichkeit jenes in jedem Blätterrauschen vernehmlichen göttlichen Grolls sich als ein Faktum zu Herzen zu nehmen und demnach, um die Gefahr abzuwenden, der ihm von der theokratischen Gesellschaft dringend empfohlenen Prozedur einer nicht bloß nominalen, sondern realen Anerkennung des Anspruchs der Götter, als die wirklichen Überflußeigner zu gelten, endlich Folge zu leisten. Umgeben von tausendfachen Zeichen des tiefen Unmuts, mit dem die Unsterblichen ihre Enteignung durch die überwältigende Realität der priesterköniglichen Macht über den Reichtum erfüllt, und konfrontiert mit unzähligen Beweisen des rasenden Zorns, den in den Göttern ihre Entrechtung durch die erdrückende Materialität der priesterköniglichen Verfügung über den Überfluß erregt, entschließt sich der Priesterkönig, die Beleidigten durch einen Akt der realen Anerkennung ihres vernachlässigten Anspruchs auf den Reichtum zu besänftigen, die Zürnenden durch eine materiale Bestätigung ihres mißachteten Titels auf den Überfluß zu versöhnen, kurz, er entschließt sich, ihnen ein Opfer zu bringen.
 |
 |
 |