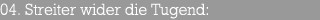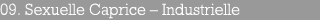2. Die Konstitution der bürgerlichen Familie
Es muß als ein Paradox ersten Ranges anmuten, daß die – egal, ob phantasmagorisch, ob homoerotisch – durchgesetzte Abschaffung des jeweils anderen Geschlechts in der Rolle eines realen Gegenüber und empirischen Widerstands und die damit einhergehende Abdankung der qua Sexualität dem einzelnen abgeforderten Entäußerungsleistung und Entfremdungserfahrung zugunsten einer ihm qua Erotik aufgegebenen narzißtischen Selbstbespiegelung und erlebten Eigenlust am Ende einer Entwicklung steht, deren Beginn vielmehr durch eine ungeheure Intensivierung des Geschlechterverhältnisses und durch die Herausbildung eines für die Sexualität als Entäußerungsleistung und Entfremdungserfahrung überhaupt erst den Boden bereitenden Zustandes heterosexueller Konfrontation und Polarisierung markiert ist, daß also, zugespitzt formuliert, die Demontage des Geschlechterverhältnisses in der Rolle eines für den Sexualtrieb grundlegenden sozialen Schauplatzes und für die sexuelle Betätigung maßgebenden realen Bezugsrahmens letzte Konsequenz und schließliches Resultat ihres genauen Gegenteils, nämlich der Etablierung des Geschlechterverhältnisses in eben dieser Rolle eines durch seine sexuelle Trägerschaft wesentlich definierten und von anderen Topoi und Bezugsgrößen unterschiedenen sozialen Orts und realen Rahmens des Sexualtriebs ist.Genau diese Vereidigung des Geschlechterverhältnisses auf das Geschlechtliche an ihm und seine damit einhergehende Besonderung und Intensivierung zu einer aus allen sonstigen gesellschaftlichen Bezügen herauspräparierten Sozialisationsform sui generis und unverwechselbaren sozialen Formation ist das andere Moment, das Kants Definition der Ehe als eines Vertrages zum "wechselseitigen Gebrauch der Geschlechtseigenschaften" festhält und bezeugt. Sosehr einerseits die Kantische Reduktion des qua Ehe institutionalisierten Geschlechterverhältnisses auf das factum brutum wechselseitiger sexueller Inanspruchnahme daran festhält, daß funktionell oder dem realen Verfahren nach Sexualität ein auf die Verfolgung eines äußeren Zwecks, den der andere ebenso objektiv vermittelt wie realiter verkörpert, gerichtetes Unterfangen ist, sosehr insistiert er andererseits aber auch darauf, daß doktrinell oder dem intentionalen Sinn nach mit der so zu seinem Kernpunkt und Wesen erklärten Sexualität das Geschlechterverhältnis eine völlig neue Pointierung erhält und sich als Sozialbeziehung ganz eigener Prägung, als quasi unabhängige Lebensform konstituiert. Den latenten Widerspruch zwischen seiner funktionellen Darstellung der Sexualität und der intentionalen Bestimmung, die er ihr gibt, nicht scheuend und offenbar entschlossen, den heterosexuellen Kontext, den er qua Ehe beschwört, von jeder heteronomen Bestimmtheit, jeder äußeren biologischen oder sozialen Zweckbindung zu befreien, erklärt Kant für den ausschließlichen Sinn und Nutzen des auf die Geschlechtsbeziehung reduzierten Geschlechterverhältnisses den "Genuß, zu dem sich ein Teil dem anderen hingibt", das heißt, die Befriedigung, die beide Geschlechtspartner einander wechselseitig gewähren und kraft deren sie sich als quasi autarkes Sozialgebilde, als selbstgenügsame Zweisamkeit etablieren. Während Kant der technischen Beschreibung nach das Geschlechterverhältnis noch als objektiven Zweckverband faßt, nimmt er zugleich der inhaltlichen Bestimmung nach in einer hochmodernen und aller traditionellen Sicht Hohn sprechenden Wendung alle objektive Zweckmäßigkeit als eine dem Verhältnis äußerliche Zutat zurück und setzt die das Verhältnis institutionalisierende Ehe als eine auf nichts als auf die Betätigung der Sexualität, auf die Befriedigung libidinöser Bedürfnisse gegründete Lebensgemeinschaft ganz eigenen Sozialcharakters.
In dieser Reduktion des Geschlechterverhältnisses auf die als ihr existentielles Wesen und intentionales Telos begriffene Sexualbeziehung bloß eine, wie man will, realistische oder zynische Rückführung der Eheinstitution auf ihren institutionslogisch-zeitlosen Kern gewahren, bloß die Offenlegung eines der Ehe zugrundeliegenden unverbrüchlich-gattungsspezifischen Natursubstrats sehen – das kann nur, wer in specie vor dem Widerspruch zwischen funktioneller Beschreibung und intentionaler Bestimmung, dem Reibungsverhältnis also zwischen "Gebrauch" und "Genuß", die Augen verschließt und wer in genere die der bürgerlichen Gesellschaft eingeschriebene Tendenz zur Enthistorisierung der jeweiligen Moderne, zur unverzüglichen Anthropologisierung jeder ihrer Errungenschaften und Entwicklungsschritte, mitmacht und deshalb ganz im Sinne Kants dessen Formulierung als systematische Aussage statt als historische Feststellung, als Darstellung eines natürlichen Sachverhalts statt als Beschreibung eines geschichtlichen Tatbestands, als Erfassung eines Elements des gesellschaftlichen Seins statt als Wahrnehmung eines Resultats des gesellschaftlichen Werdens versteht.
Tatsächlich ist, entgegen dem von Kant nicht nur erzeugten, sondern durchaus auch geteilten Eindruck einer normativ-systematischen statt bloß situativ-historischen Stellungnahme, die Kantische Bestimmung speziell der Ehe als eines Vertrages "zum Gebrauch der Geschlechtsorgane des anderen" und damit generell des Geschlechterverhältnisses als einer durch nichts als Sexualität ausgezeichneten besonderen Sozialbeziehung theoretisches Fazit einer bis in die Anfänge der bürgerlichen Gesellschaft zurückreichenden und im 18. Jahrhundert ihren vorläufigen Abschluß findenden praktischen Entwicklung, in deren Verlauf das Geschlechterverhältnis seiner traditionellen Einbettung beziehungsweise Einbindung in andere gesellschaftliche Verhaltensweisen und Verbindlichkeiten beraubt, aus dem durch Arbeit vermittelten und in Formen kommunaler Geselligkeit gepflegten sozialen Leben und öffentlichen Zusammenhang halbwegs herausgelöst und als ein ganz eigenes, zwar von der Gesellschaft geschütztes und gefördertes, aber doch wesentlich von ihr ausgeklammertes und zur Privatsphäre des familiären Bereiches abgesondertes soziales Phänomen neu etabliert wird. Verantwortlich für diese Entwicklung ist die Trennung von häuslicher Sphäre und Produktionsbereich, Wohnort und Arbeitsplatz, wie sie sich seit dem 16. Jahrhundert, seit den Anfängen der aus der ursprünglichen Akkumulation hervorgehenden und diese zu einer Umwälzung der Produktionsverhältnisse nutzenden bürgerlichen Gesellschaft unaufhaltsam vollzieht. Daß im Zuge dieser Entwicklung die Arbeit kapitalisiert wird, will heißen, die Arbeitenden sich von ihren traditionellen Produktionsmitteln getrennt und qua Lohnarbeit in mechanistisch-manufakturelle beziehungsweise technisiert-industrielle Zusammenhänge hineingetrieben finden, bedeutet auch, daß die Arbeitenden ihre Arbeit nicht mehr an ihrem Wohnort, in ihrem unmittelbaren Lebenszusammenhang, ihrem familiären Milieu verrichten können, sondern daß sie dazu eigene Arbeitsstellen, besondere Produktionsstätten, separate Betriebe aufsuchen und tagtäglich oder vielmehr tagnächtlich zwischen Wohnort und Arbeitsstelle hin und her pendeln müssen.
Diese räumliche Verlegung und objektive Abtrennung der dem Erwerb dienenden Arbeitstätigkeit muß nolens volens tiefgreifende Rückwirkungen auf die Familiensituation in genere und die eheliche Beziehung in specie haben. Solange die Arbeit im familiären Betrieb, in der häuslichen Werkstatt verrichtet wird, bleibt sie eine die ganze Familie angehende und engagierende Aktivität. Auch wenn, wie durchweg in den traditionellen handwerklichen Familien und weniger ausgeprägt auch in den Viehwirtschaft treibenden oder größere Landflächen beackernden bäuerlichen Betrieben der Fall, die Arbeitsteilung und Spezialisierung der Produktion soweit fortgeschritten ist, daß die für den Broterwerb zentralen Arbeitsgänge einem darauf spezialisierten Mitglied der Familie, normalerweise dem Mann, überlassen bleiben und Frau und Kinder nicht unmittelbar davon in Anspruch genommen werden, sind die letzteren doch zugegen und leisten teils Handlangerdienste zu dem zentralen Geschäft, teils sorgen sie für die Schaffung und Erhaltung der hauswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen das zentrale Geschäft sich vollzieht. Daß die Hausfrau putzt, handarbeitet, wäscht und kocht, ist für die im familiären Betrieb beschäftigten Angehörigen beziehungsweise in den Familienzusammenhang eingegliederten Gesellen und Lehrlinge oder Knechte und Mägde kein ihrer eigenen Arbeit äußerliches Moment, sondern ein diese Arbeit tragender und konditionierender Faktor; durch ihre hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, durch die Pflege des mit dem Arbeitsplatz verknüpften Logis, durch die Zubereitung der den Arbeitsprozeß skandierenden Mahlzeiten, durch die Instandhaltung der für die Arbeit erforderlichen Kleidung, durch die Ansprache, die sie bietet, und die Geselligkeit, für die sie sorgt, ist die Hausfrau unabdingbar auf das familienbetriebliche Arbeitsleben bezogen und in ihm engagiert.
Und umgekehrt ist auch der mit der Broterwerbstätigkeit unmittelbar Befaßte, im Normalfall der Mann, im Haus zugegen und nimmt teil an den hauswirtschaftlichen Planungen und Entscheidungen, wie er auch Instandhaltungsarbeiten und besonderen Kraftaufwand verlangende Aufgaben übernimmt. Was Mann und Frau unter diesen Umständen tun und beginnen, ist demnach ein bei aller funktionellen Arbeitsteilung substantiell gemeinsames Anliegen, ein kraft des räumlichen Miteinander und der intentionalen Verschränkung der jeweiligen Tätigkeiten soldarisch betriebenes Projekt; geschäftlicher Broterwerb und hauswirtschaftliche Sorge für die Familie lassen sich sowenig trennen, daß in vielen Fällen betriebliche und familiäre Buchführung, die Finanzen des Geschäfts und die des Haushalts der Einfachheit halber in einer Hand, nicht selten in der der Hausfrau, zusammengeführt sind.
Dieses gemeinsame Wirtschaften, diese gemeinschaftliche Planung, Organisation und Ausübung räumlich zusammenhängender und intentional verschränkter Arbeiten und Tätigkeiten hört in dem Maß auf, wie die kapitale Umrüstung der Produktion aus der gesellschaftlichen Arbeit eine im Abseits besonderer faktoreller Einrichtungen, in der Abgeschlossenheit eigener Produktionsanstalten geübte Lohntätigkeit macht. Der Broterwerber, normalerweise der Mann, geht nun alltäglich hinaus an seinen Arbeitsplatz, verschwindet in einer Werkstatt, einem Manufakturbetrieb, einer Fabrik, und verrichtet dort, abgelöst von dem bis dahin gewohnten Rahmen des häuslichen Lebens und des familiären Alltags, seine Arbeit. Die für die Hauswirtschaft zuständige Person, im Normalfall die Frau, erfüllt ihre um den Brotbetrieb als organisierendes Zentrum gekürzten und damit auch des direkten gesellschaftlichen Bezugs, der unmittelbaren Verknüpfung der Sorge um die Familie mit der Versorgung der Gesellschaft beraubten hausfraulichen Aufgaben.
Was bleibt unter diesen Umständen dem Geschlechtspaar noch an tatsächlicher Gemeinsamkeit, an praktischer Teilhabe, die sich in Formen der Planung, Organisation und Produktion realisiert, an empirischem Zusammenleben, das im konkreten Raum und in der alltäglichen Zeit vor sich geht und sich nicht auf morgendliche oder abendliche Informationen über die in der je eigenen Sphäre getrennt zu verrichtenden oder verrichteten Geschäfte beschränkt? Nichts weiter bleibt dem Paar als seine Geschlechtlichkeit, seine im "wechselseitigen Gebrauch der Geschlechtseigenschaften", im Genuß der sekundären und primären Geschlechtsmerkmale des anderen bestehende Beziehung. Mangels sonstiger praktischer Gemeinsamkeit und Zusammenleben stiftender Alltagsperspektive wird der sexuelle Verkehr, die gegenseitige Inanspruchnahme als geschlechtliche Wesen zur Basis des Miteinander, zur tragenden Bestimmung des Verhältnisses zwischen Mann und Frau.
Nicht, daß in der traditionellen Lebensgemeinschaft, die Familie und Betrieb, Hauswirtschaft und Broterwerb unter einem Dach oder in einem Gehöft zusammenhält, der sexuelle Verkehr und das durch ihn zwischen Mann und Frau gestiftete Band fehlten! Aber sowohl nach der Seite ihrer praktischen Entfaltung als auch nach der ihrer strategischen Bedeutung ist die geschlechtliche Beziehung klar beschränkt und eindeutig determiniert, in einen größeren Zusammenhang eingegliedert und einer allgemeineren Zielsetzung untergeordnet. Sie ist ein Moment des gemeinsamen Lebens, das sich nach der Decke des Alltags strecken, im Ensemble der Alltagsverrichtungen seinen Platz finden oder vielmehr mit seiner Nische vorlieb nehmen muß; sie ist unter vielen gemeinschaftlichen Projekten und Aktivitäten ein weiterer Programmpunkt, der keineswegs Priorität beanspruchen kann, der in puncto Dringlichkeit vielmehr weit hinten auf der Tagesordnung rangiert und in seiner auf strikte Zweisamkeit angelegten Besonderung hinter den allgemeineren hausgenossenschaftlichen Ansprüchen und nachbarschaftlichen Verpflichtungen, die mit den übrigen gemeinsam betriebenen Geschäften zumeist verknüpft sind, zurückstehen muß. Und wie die geschlechtliche Beziehung empirisch in den Lebensalltag des Paares eingebunden, so ist sie auch systematisch an ihn und seine Zielvorgaben zurückgebunden. Die gemeinsame sexuelle Betätigung der beiden, ihr wechselseitiger Gebrauch der Geschlechtswerkzeuge, ist mit anderen Worten streng an den Fortpflanzungszweck, die Erzeugung von Nachkommenschaft, geknüpft. Und dies nicht etwa, weil die Natur – die "Qui est cette dame?" biologistischen Aufklärichts – es so will, und auch nicht etwa, weil eine christlich-abendländische Kulturtradition – das Abrakadabra romantischer Reaktion – darauf besteht, sondern weil die Erzeugung einer zahlreichen Nachkommenschaft integrierender Bestandteil der gemeinsam verfolgten ökonomischen Selbsterhaltung und sozialen Existenzsicherung der Betreffenden ist. Sowohl in der Eigenschaft von wohlfeilen Arbeitskräften, die den Eltern in Hauswirtschaft und familiärem Betrieb zur Hand gehen und im Alltag eine Hilfe sind, als auch in der Funktion von Erben und Geschäftsnachfolgern, die den Eltern ihre familiären und sozialen Verpflichtungen abnehmen und ihnen im Alter eine Stütze sind, erweisen sich Kinder als zwingendes Erfordernis und integrierender Bestandteil der Lebensbewältigung und einer auskömmlichen Existenz.
Wenn deshalb die geschlechtsspezifische Beziehung zwischen den Geschlechtern, ihr gemeinsames sexuelles Handeln, wesentlich auf Ge- schlechtsverkehr im strengen Sinne als auf das probate Mittel zur Fortpflanzung, zur Erzeugung von Kindern, gerichtet und konzentriert ist, so nicht, weil das in der Natur des Menschen läge, und auch nicht primär, weil es kulturellen Gepflogenheiten entspräche, sondern weil es im Selbsterhaltungsinteresse der als gesellschaftliches Paradigma firmierenden handwerklichen und bäuerlichen Familienbetriebe liegt, ihrem Anspruch auf ein kontinuierliches und gedeihliches Auskommen entspricht. Daß sekundär dann auch kulturelle Rücksichten, moralische Traditionen und religiöse Vorschriften, ins Spiel kommen, um dieser Konzentration der Sexualität auf die Fortpflanzungsaufgabe praktische Geltung zu verleihen, bleibt unbestritten und beweist nichts weiter als die Tatsache, daß gesellschaftliche Zwänge im Unterschied zu natürlichen Bedrohungen keine instinktiven oder automatischen Verhaltensreaktionen auslösen, sondern daß, sofern sie gesellschaftlichen Ursprungs sind, selbst objektivste Notwendigkeiten der Vermittlung mit dem gesellschaftlichen Bewußtsein der einzelnen und mit ihrem individuellen Dafürhalten bedürfen, um Verbindlichkeit für sie zu erlangen und verhaltensprägend wirken zu können.
Mit dieser doppelten Beschränkung und Disziplinierung des geschlechtlichem Moments im Geschlechterverhältnis – seiner Einbindung in den gemeinsamen Alltag und Reduktion auf eine beiläufige Nischenexistenz einerseits und seiner Anbindung an die gemeinschaftliche Überlebensstrategie und Festlegung auf eine abhängige Hilfsfunktion andererseits – ist es nun also vorbei. Indem die sozialen Wirkungskreise der Geschlechtspartner räumlich und in der Folge auch funktionell auseinandertreten und klar voneinander geschieden werden, hört der gemeinsame Alltag praktisch auf, zu existieren, und reduziert sich die alltägliche Gemeinsamkeit im wesentlichen auf jenes ganz eigene soziale Verhältnis, das, für sich genommen und weitgehend abstrahiert von den übrigen gesellschaftlichen Beziehungen, das Geschlechtsleben darstellt. Auf die Zeiten außerhalb der normalen gesellschaftlichen Tätigkeiten, auf die Ruhepausen zwischen den arbeitsförmigen Vergesellschaftungsprozessen, kurz, auf die Feierabende und Feiertage beschränkt, ist das Zusammenleben der Geschlechter in der Hauptsache Geschlechtsleben, ein auf die Betätigung der Sexualität in allen ihren genitalen Funktionen und derivativen Formen gerichtetes Sichaufeinanderbeziehen.
So einschneidend und folgenreich diese Veränderung für das Geschlechterverhältnis langfristig aber auch ist, so geringfügig sind seine kurzfristigen Folgen und unmittelbaren Auswirkungen. Der Grund dafür ist, daß die im Prinzip radikale Reduktion des Geschlechterverhältnisses auf die geschlechtliche Beziehung durch gleichzeitige gesellschaftliche Entwicklungen oder Anforderungen in ihren Konsequenzen entweder konterkariert oder neutralisiert wird. Ersteres ist speziell in den unteren Schichten der Fall, wo einerseits eine fortschreitende Verschärfung der außer Haus bestehenden Arbeitsbedingungen vornehmlich in Richtung auf eine Verlängerung des Arbeitstages und eine Vergrößerung und Intensivierung der Arbeitsleistung und andererseits eine zunehmende Einbeziehung von Frauen in manufakturelle und konfektionelle Arbeitsprozesse, mithin die parallele frühkapitalistische Ausbeutung beider Geschlechter, die körperliche und geistige Belastung für die Betroffenen so massiv steigert, daß die Ruhepausen zwischen den Arbeitstagen kaum mehr den allernötigsten Regenerationserfordernissen genügen und daß an eine Entfaltung des Geschlechterverhältnisses, die über die Erfüllung der Reproduktionsaufgabe hinausginge und die neuen Chancen einer von sonstigen Gemeinsamkeiten befreiten wesentlich sexuellen Gemeinschaft reell nutzte, gar nicht zu denken ist.
Das Geschlechterverhältnis wird hier zur Notgemeinschaft, die beide Beteiligten weitgehend im getrennten Nebeneinander des täglichen, arbeitsbestimmten Überlebenskampfes aufgehen läßt und das Miteinander zu Hause auf die regenerativen Funktionen des Essens und Schlafens und den wechselseitigen Gebrauch der Geschlechtswerkzeuge in reproduktiver Absicht beschränkt. Am Zwang zur Fortpflanzung ändert sich nichts; er gwinnt höchstens noch an Stärke. Als Alterssicherung und als Hilfstruppe sei's beim Broterwerb, sei's im Haushalt und bei der Geschwisterbetreuung ist eine möglichst zahlreiche Nachkommenschaft für die zunehmend pauperisierten Unterschichten mehr denn je ein unabdingbares Erfordernis, das die geschlechtliche Beziehung beherrscht und prägt.
Auch für die neuen bürgerlichen Mittelschichten, die im Gefolge der Kapitalisierung der Produktionsmittel und der Verwandlung von Arbeit in Lohnarbeit entstehen und die direkt oder indirekt von dem Wohlstand, den die neue Produktionsweise hervortreibt, profitieren – auch für diese Mittelschichten bleibt die Fortpflanzung ein das Geschlechterverhältnis beherrschender Imperativ. Zwar vielleicht nicht das unmittelbare Überleben, wohl aber die biographische Sicherung im Alter und die strategische Absicherung im Konkurrenzkampf, das heißt, die spätere Aufrechterhaltung des Geschäfts oder Gewerbes durch Kinder ebenso wie die akutere Herstellung geschäftlicher Beziehungen und gesellschaftlicher Verbindungen durch die Verheiratung von Kindern, lassen auch hier die Erzeugung einer zahlreichen Nachkommenschaft als unverändert zwingendes Gebot erscheinen. Obwohl in diesen Schichten die Frau zu Hause bleibt und sich in ihrem Tätigkeitskreis auf die Erfüllung hauswirtschaftlicher Aufgaben beschränkt sieht, ist sie durch die Aufzucht ihrer zahlreichen Kinder voll und ganz in Anspruch genommen. Dies um so mehr, als die allmähliche Verbesserung der hygienischen Bedingungen und der medizinischen Betreuung, die das 17. und vor allem dann das 18. Jahrhundert mit sich bringen, das Fortpflanzungsgeschäft zunehmend ertragreicher werden lassen und eine anhaltende Rückläufigkeit der hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit zur Folge haben, die den Nachwuchs traditionell dezimierte und das Kinderkriegen zu einem eher durch die Schwangerschaften als durch den Umfang der Versorgungs- und Erziehungsaufgaben beschwerlichen Unterfangen machte.
Hinzu kommt, daß durch den neuen relativen Wohlstand, den die Kapitalisierung der gesellschaftlichen Produktionsmittel und der gesellschaftlichen Arbeit den bürgerlichen Schichten beschert, und durch die Vermehrung und Diversifizierung von Gebrauchsgütern und Bedürfnisbefriedigungsmitteln, die der auf Basis solcher Kapitalisierung (und der kolonialistischen Eroberungen, die mit ihr Hand in Hand gehen) rasch expandierende Markt den Wohlhäbigen zur Verfügung stellt, die Arbeiten im Haushalt an Volumen, Vielseitigkeit und Intensität zunehmen und die Hausfrau teils als eigenhändig tätige Besorgerin und Verrichterin, teils als durch Personal wirkende Verwalterin und Schaffnerin mit allen ihren handarbeitlichen, organisatorischen, logistischen und kalkulatorischen Fähigkeiten gefordert ist.
Unter diesen Umständen hat auch in den bürgerlichen Mittelschichten die sozial oder funktionell vollzogene Reduktion des Geschlechterverhältnisses auf die Geschlechtsbeziehung keine Chance, reale Geltung zu erlangen und sich zu einem habituellen Lebensstil mit eigenen Ausdrucksformen zu entfalten. Kaum ist das Geschlechterverhältnis seiner traditionellen sozialen Verbindlichkeiten und funktionellen Gemeinsamkeiten ledig, finden die Betroffenen das Geschlechtsleben, das sich ihnen pro forma ihrer abstrakten Zweisamkeit eröffnet, auch schon per modum der mit Vorrang versehenen Fortpflanzungstätigkeit ins Familienleben überführt, in jene Formen von feierabendlicher oder feiertäglicher Geselligkeit, die entstehen, weil der außerhalb des Hauses arbeitende Mann zwar nach der Heimkehr von seiner Tätigkeit zum Müßigang entsozialisiert und insofern zur Wahrnehmung der in der Reduktion des Geschlechterverhältnisses auf die Geschlechtsbeziehung angelegten speziellen Sozialisierungsperspektive frei ist, die im Haushalt wirkende Frau dagegen in ihre mütterlichen und hausfraulichen Pflichten eingespannt bleibt und insofern für eine Wahrnehmung der neuen Perspektive nicht zur Verfügung steht, und weil diese Konstellation zu einer Kompromißbildung treibt, bei der das hausfrauliche Tun in die Zweierbeziehung als formellen Rahmen eingebracht und darin nun aber als inhaltliche Spezifizierung der Zweisamkeit geltend gemacht wird. Das von hausfraulichen Verrichtungen, von Kinderpflege, Nahrungszufuhr, Handarbeiten, Bildung, moralischer Erziehung, Lebensart und innerfamiliärer Kommunikation begleitete und erfüllte Eheleben – es konstituiert eine zwar nicht mehr durch gesellschaftliche Arbeit und reale Intention, dafür aber ersatzweise durch Kindersozialisation und bürgerliche Kultur vermittelte Gemeinschaft der Geschlechtspartner, in der sich die pro forma ihrer Loslösung von sonstigen sozialen Zusammenhängen und anderen intentionalen Rücksichten zum Sozialverhältnis sui generis emanzipierte Geschlechtsbeziehung pro materia der ihr nachgewiesenen sekundären gesellschaftlichen Funktionen zum Familienleben, wie man will, neutralisiert oder sublimiert findet.
Als eine Konstruktion, die das ökonomisch bedingte Ausscheiden des Geschlechterverhältnisses aus dem gesellschaftlichen Arbeits- und Lebenszusammenhang in seinen sexualdynamischen Auswirkungen und seinen sozialpraktischen Konsequenzen auffängt und abfedert, genießt die bürgerliche Familie von Anfang an hohe gesellschaftliche Wertschätzung, die ihr bis zum heutigen Tag im wesentlichen erhalten geblieben ist. Kunst und Literatur, Wissenschaft und Ideologie, Staat und Parteien, Institutionen und Verbände – sie werden allesamt nicht müde, die um die Hausfrau und Mutter, die Frau am Herd drapierte Familie als ein Arrangement zu feiern, durch das es gelingt, das seiner sozialen Dimensionen und intentionalen Perspektiven beraubte Geschlechterverhältnis vor der Reduktion auf eine reine, zum Pandämonium asozialen Triebverhaltens sich entfaltende Geschlechtsbeziehung zu bewahren und in einen der Gesellschaft angegliederten und ihr zuarbeitenden sozialen Kosmos sui generis zu verwandeln. Bei aller offiziellen Wertschätzung des familiären Tableaus, zu dem sie sich solcherart zusammenfinden, sind indes die Betroffenen selbst, die Geschlechtspartner, Mann und Frau, mit ihrer das traute Heim stiftenden ehelich-elterlichen Sondervergesellschaftung nicht unbedingt zufrieden. Zu penetrant vermittelt diese Vergesellschaftungsform den Eindruck, weder Fisch noch Fleisch zu sein, zu sehr präsentiert sie sich als anämisch-mediokrer Kompromiß zwischen den abgewehrten Extremen genossenschaftlich verbindender Arbeit und partnerschaftlich paarender Sexualität, um nicht bei den Betroffenen einen Beigeschmack der Künstlichkeit und Fadheit zu hinterlassen – jenen Beigeschmack, den das mit der Verklärung von Ehe und Familie betraute offizielle Jubelprogramm dadurch zu vertuschen sucht, daß es die Künstlichkeit zur Gemütlichkeit stilisiert, die Fadheit zur Süßlichkeit sentimentalisiert.
Dabei ist in scheinbarer Paradoxie die Unzufriedenheit des Mannes größer als die der Frau. Zwar ist, aufs Ganze der mittels Kapitalisierung der gesellschaftlichen Produktionsmittel durchgesetzten geschlechtsbezüglichen Arbeitsteilung gesehen, der Mann der eindeutig Begünstigte bei dieser Trennung von Haus und Arbeit, privater und öffentlicher Tätigkeit, Wirken in der Familie und gesellschaftlicher Aktivität, weil er es ja ist, der bei seinem Auszug aus der Hauswirtschaft die Sphäre der gesellschaftlichen Arbeit mitnimmt beziehungsweise sie draußen reorganisiert vorfindet und als seine Domäne mit Beschlag belegt, während die Frau sich mit dem Rest, dem zur Privatsphäre degradierten Haushalt, der ihres öffentlichen Bezugs beraubten Familie abgespeist findet. Aber im besonderen des auf Basis dieser Sphärentrennung neu definierten Geschlechterverhältnisses schlägt dem Mann seine allgemeine Begünstigung eher zum Nachteil aus.
Er, der den durch Arbeit und Gesellschaftlichkeit definierten eigentlichen Mittelpunkt seines Lebens außerhalb des Hauses hat, findet sich bei der feierabendlich-feiertäglichen Rückkehrs ins Haus für einen Zusammenhang rekrutiert, der ihn zu einem Statistendasein verurteilt, ihm die Rolle eines ebenso funktionslosen wie hochgeehrten Gastes in den eigenen vier Wänden zuweist. Statt sich mit seiner Geschlechtspartnerin in die sexuelle Perspektive vertiefen und auf die Entfaltung der libidinösen Beziehung einlassen zu können, die ihnen die Entsozialisierung des Geschlechterverhältnisses formell eröffnet, findet er erstere bereits als Hausfrau und Mutter für neue quasisoziale Aufgaben in Anspruch genommen und mit der Führung eines als Zuliefererbetrieb zum Unternehmen Gesellschaft wohlverstandenen Familienlebens beschäftigt, das ihn ebensosehr als ideellen Organisator und exzentrischen Erhalter braucht, wie es ihn als reellen Faktor entbehrlich sein läßt und zur Unlebendigkeit einer vom konzentrischen Verwalter, der die Frau ist, bloß hofierten und rituell hochgehaltenen Repräsentationsfigur verurteilt. Weder von Arbeit okkupiert, noch durch Sexualität in Anspruch genommen, und in die undankbare Rolle des bestenfalls vage Rührung, im Zweifelsfall aber akute Langeweile verspürenden stillen Teilhabers am Familienleben gedrängt, ist der Mann hier der Dumme, ist er das unfreiwillig häusliche Opfer seiner eigenen gesellschaftlichen Privilegierung.
Demgegenüber ist die Frau besser dran. Zwar mag sie sich im Blick auf die Lebensführung als ganze benachteiligt fühlen, mag sie zu Recht den Eindruck haben, mit dem Auszug des Mannes aus dem Haus und der damit einhergehenden Evakuierung der Gesellschaft aus der Familie des unmittelbaren gesellschaftlichen Bezuges verlustig gegangen und als Privatsache des Mannes im Hause ebenso eingesperrt wie auf innerhäusliche Verrichtungen reduziert zu sein. Aber dieses wohlbegründete Gefühl der Diskriminierung wird doch zugleich dadurch abgemildert, wo nicht sogar versöhnlich gestimmt, daß der Verlust an gesellschaftlicher Arbeit und öffentlichem Bezug, den sie erleidet, nicht einfach gleichbedeutend ist mit ihrer Verurteilung zu einem ebenso abstrakten wie privaten Sexualverhältnis, ihrer Reduktion auf eine durch leibliche Fürsorge und geschlechtliche Zuwendung bestimmte personale Beziehung zu einem ihr als Sachwalter der Gesellschaft und Repräsentant der Öffentlichkeit zugeordneten Mann, sondern daß durch die neuen Aufgaben der hauswirtschaftlichen Organisation, der Kinderaufzucht und der Kulturpflege, die sie in diesem reduktiv geschlechtlichen Rahmen zugewiesen bekommt, jener Verlust halbwegs wieder aufgewogen wird, eine Art von Kompensation erfährt. Statt sich jeglicher Gesellschaftlichkeit beraubt und durch diese Privation auf ein in der Geschlechtsbeziehung als restbeständigem intersubjektivem Verhältnis aufgehendes Privatwesen zurückgestaucht zu finden, bekommt die Frau mit der Familie eine zur Keimzelle oder Grundform der Gesellschaft idealisierte oder vielmehr ideologisierte spezielle Form von gesellschaftlicher Tätigkeit oder Vergesellschaftungsfunktion übertragen, die zwar nicht unbedingt als Wiedergutmachung für das Entgangene gelten kann, sich immerhin aber – zumal im Verein mit den sekundären Befriedigungen der ökonomischen Sicherheit, psychischen Geborgenheit und emotionalen Erfüllung, die sie unter Umständen gewährt – als eine ernstzunehmende und von der Frau auch ernstgenommene Entschädigung erweist.
Hält aber das Familienleben samt all den Tätigkeiten, die an es geknüpft sind, sogar mit dem aus gesellschaftlicher Arbeit und Öffentlichkeit bestehenden Leben, für dessen Entzug es als Kompensation dient, gegebenenfalls den Vergleich aus, so werden seine eigentlichen Vorzüge, wird das, was das Familienleben über alle bloß kompensatorische Funktion hinaus der Frau lieb und teuer machen kann, erst in dem engen, als Geschlechtsbeziehung sans phrase, als feierabendlich-feiertäglich abstraktes Zusammensein von Mann und Frau definierten Rahmen sichtbar, auf den sich das seiner unmittelbaren gesellschaftlichen Aspekte beraubte Geschlechterverhältnis reduziert hat. Hier nämlich, in diesem eingeengten Rahmen, ist die Frau durch ihre hausfraulich-mütterliche Funktion und ihre dadurch gewährleistete tätige Ausgefülltheit im Vorteil gegenüber dem Mann, für den das Zusammensein nur Öde und Leere bereithält, nur Untätigkeit und Langeweile bedeutet. Zwar ist es eben dies der Frau als ihre spezifische Aktivität übertragene Familienleben, das jene Öde und Leere schafft, indem es die freie Entfaltung des Geschlechtslebens, die Ausbildung der Sexualität zu einer Lebensform sui generis verhindert, aber weil auch die freieste Entfaltung des Geschlechtslebens der Frau keinen Ersatz für den ihr geraubten gesellschaftlichen Zusammenhang bieten könnte und, anders als für den Mann, für den es eine willkommene Ergänzung zum öffentlichen Arbeitsleben wäre, nur ihre Verstoßung ins Privatleben und Degradierung zu einer persönlichen Zusatzbestimmung des Mannes komplett machen müßte, hat in der Tat die Frau allen nur denkbaren Grund, die kompensatorisch soziale Aufgabe, die ihr qua Familienleben übertragen wird, als einen im Rahmen der Geschlechtsbeziehung doppelten Gewinn zu verbuchen: nämlich als etwas, das sie davor bewahrt, der Reduktion auf ein aller persönlichen Wünschbarkeit zum Hohn mit der Vernichtung ihrer gesellschaftlichen Existenz gleichbedeutendes Geschlechtsleben zu verfallen, und das sie im gleichen Atemzug davor schützt, Opfer der Langeweile und Leere zu werden, die mit der Fehlanzeige des durchs Familienleben verdrängten Geschlechtslebens einhergeht.
Diese Leere ist, wie gesagt, das Los des Mannes, der bei der Rückkehr von seiner gesellschaftlichen Arbeit bereit wäre, sich zur Ergänzung seiner gesellschaftlichen Existenz mit der Geschlechtspartnerin auf das ihnen verbliebene gemeinschaftliche Anliegen einer Entfaltung ihres Geschlechtslebens einzulassen und der indes die Geschlechtspartnerin anderweitig okkupiert und nämlich ebensosehr zu ihrem existentiellen Schutz wie zu ihrem praktischen Frommen mit dem Aufbau und der Erhaltung des Familienlebens befaßt findet. Während er sich langweilt, geht sie ihren hausfraulich-mütterlichen Geschäften nach, während er sich zur Passivität verurteilt sieht, ist sie aktiv, während er das durchs Familienleben verhinderte Geschlechtsleben als die ersehnte Ergänzung zum Arbeitsleben, als die es ihm erscheint, vermißt, genießt sie das Familienleben, weil es gleichermaßen ihre Reduktion auf ein totalisiertes Geschlechtsleben verhindert und ihr etwas bietet, das sowohl das ihr vorenthaltene Arbeitsleben als auch das ihr entgangene Geschlechtsleben zu kompensieren taugt.
Und so erklärt sich denn auch der auf den ersten Blick paradoxe Umstand, daß es vorzugsweise der durch die Reorganisation der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse eindeutig begünstigte Mann ist, dem die Neuordnung des Geschlechterverhältnisses, die damit Hand in Hand geht, Unlust bereitet und der gegen das Resultat dieser Neuordnung, das an den Kristallisationspunkt ehelicher Zweisamkeit anschießende Famlienleben, aufbegehrt. Dabei nimmt sein Aufbegehren teils die Form praktisch-realer Sabotage, teils die Gestalt theoretisch-mentaler Reserve an. Im ersteren Fall sucht der Mann, sich dem Familienleben nach Möglichkeit zu entziehen, und rottet sich mit seinesgleichen zusammen, um sich mit allerlei Kurzweil, mit Sport, Spiel, Trinken, Politisieren und Hobbytätigkeiten die Zeit zu vertreiben. Das heißt, er nimmt im Blick auf das Geschlechterverhältnis eine mehr oder minder ausgeprägte Verweigerungshaltung ein, lehnt dieses Verhältnis als die Geschlechtsbeziehung, auf die es sich formell reduziert zeigt und als die es sich doch zugleich materiell nicht oder nur in der alles Geschlechtsleben, wie man will, sublimierenden oder neutralisierenden, aufhebenden oder unterbindenden Form des Familienlebens verwirklicht, weitgehend ab und beschränkt seine Mitwirkung daran auf die mehr oder minder abstrakte Fortpflanzungstätigkeit und die zur Befriedigung seiner Nahrungs- und Schlafbedürfnisse erforderliche Präsenz.
Diese Rückzugs- und Ausweichbewegung, mit der der Mann auf die Zumutung eines Familienlebens reagiert, das als Domäne der Frau ihn ebensosehr von sich ausschließt und zur passiven Teilhabe verurteilt, wie es ihn an der Entfaltung einer qua Geschlechtsleben spezifischen neuen Geschlechterbeziehung hindert – diese Fluchtbewegung heraus aus der familiär bestimmten Zweisamkeit weist als profane Antwort auf die gesellschaftliche Heiligsprechung und Verklärung von Ehe und Familie eine ebenso große Stereotypie wie letztere auf und begleitet sie im öffentlichen Bewußtsein wie der Schatten das Licht, ist in Karikaturen, in Sentenzen, in Gassenhauern, in Witzen ebenso omnipräsent, wie der Lobpreis des Familienlebens die Bilder, die Reden, die Dichtung, die Unterweisungen erfüllt.
Ganz im rein negativen Fluchtreflex befangen, ganz ohne positive Wendung bleibt die praktisch-reale Sabotage des familiär bestimmten Geschlechterverhältnisses durch den Mann zwar vielleicht nicht. Indiz für einen schwachen Versuch des Mannes, die ihm in der Zweisamkeit der Ehe ebenso reell versagte, wie formell in Aussicht gestellte Entfaltung der Geschlechtsbeziehung dennoch einzufordern, dürfte der Aufschwung sein, den seit dem 18. Jahrhundert ein altes Gewerbe, die Prostitution, erlebt. Als eine Einrichtung, die zumindest allen entwickelten Gesellschaften mit herrschaftlicher Organisation der Arbeit und des Krieges eigentümlich und im Sinne eines Kompensationsmechanismus für die mit solch heteronomer Organisation verknüpfte Triebunterdrückung und Triebversagung in der Tat auch unentbehrlich ist, ist die Prostitution zwar alles andere als ein Geschöpf der bürgerlichen Neuzeit. Immerhin aber kann die quantitative Zunahme und qualitative Etablierung, die dieses Gewerbe parallel zur Ausbildung der bürgerlichen Gesellschaft erlebt, wie einerseits – der qua sexuelles Angebot zureichenden Bedingung nach – als Folge der Pauperisierung und Proletarisierung der die Industrialisierung tragenden unteren Schichten, so andererseits – von der qua sexuelle Nachfrage wirkenden Ursache her – als Resultat der ineins die Sexualisierung und die Neutralisierung des Geschlechterverhältnisses bewirkenden brisanten Konstellation gelten, die in den von der Industrialisierung profitierenden, wohlhäbigen bürgerlichen Mittelschichten im Kult des Familienlebens ihren ebenso symptomatischen wie änigmatischen Ausdruck findet. Mag, mit anderen Worten, die praktische Reaktion des Mannes auf die frustrierende Paradoxie einer in der Zweisamkeit des Familienlebens gleichzeitig in den Vordergrund und außer Reichweite gerückten Geschlechtsbeziehung im wesentlichen in Sabotage, das heißt, darin bestehen, daß der Mann sich aus dem Familienleben in andere nichtgeschlechtliche Formen von nicht durch Arbeit vermittelter Geselligkeit flüchtet – die quantitative Zunahme und institutionelle Ausbreitung, die im Zuge der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft die Prostitution erfährt, läßt sich durchaus als ein Moment von praktischer Initiative, das sich nicht in der Sabotagereaktion erschöpft, interpretieren, als eine Art von Gegenoffensive des Mannes, von tätiger Reklamation des im Familienleben vorenthaltenen Geschlechtslebens verstehen.
Allerdings ist – und darin liegt die solch praktischer Initiative eigene, nicht minder frustrierende Paradoxie – die qua Prostitution vorgetragene Gegenoffensive zwangsläufig Umorientierung auf ein Surrogat, die Reklamation des vorenthaltenen Geschlechtslebens unfehlbar gleichbedeutend mit einer unheilbaren Degradation des Reklamierten. Indem der Mann zwecks Einforderung des ihm vorenthaltenen Geschlechtslebens auf eine traditionelle gesellschaftliche Veranstaltung im Dienste der Kontrolle und Manipulation des Geschlechtslebens, eben auf die Prostitution, rekurriert, unterwirft er sich nolens volens deren bestimmenden Prinzipien und organisierenden Gesetzmäßigkeiten. Oberstes Prinzip aber des Geschlechtskontrollmechanismus Prostitution, das alle übrigen Gesetzmäßigkeiten durchdringt und kraftlinienförmig ausrichtet, ist die Unterdrückung und Versagung des Geschlechtstriebes im Namen der Verrichtung gesellschaftlicher Arbeit und der Ausübung gesellschaftlicher Herrschaft. Zwar ist die Prostitution nun der leibhaftige Beweis dafür, daß diese Unterdrückung und Versagung nicht vollständig gelingt und daß es eines Ventils für das Unterdrückte, einer Äußerungsmöglichkeit für das von der Versagung Betroffene bedarf; aber weil sie eben nur als Ventil, als Abfuhrvorrichtung für übermäßigen Druck fungiert, läßt sie das Unterdrückte auch nicht in seiner ursprünglichen Gestalt, sondern nur sub conditione dessen, wodurch es unterdrückt wird, zum Vorschein kommen und bringt, mit anderen Worten, das Geschlechtsleben nur symptomatisch, nur in unheilvoller Amalgamierung mit den Bedingungen seiner Negation zum Ausdruck. Bestenfalls verwirklicht die Prostitution das verhinderte Geschlechtsleben als flüchtigen Einschub, verstohlenen Zwischenfall, erratischen Einbruch ins Kontinuum der von der Präsenz des Geschlechtstriebs befreiten Normalität, schlimmstenfalls reduziert sie es auf eine bloße Störung dieser Normalität, eine sie heimsuchende, halb selbstverleugnende, heterodoxe Anwandlung, eine durch ihre Deformation, ihre Partialität, ihre Perversion sich selbst verratende Abnormität.
Die Prostitution rehabilitiert das Geschlechtsleben nicht, sie reminisziert es nur; sie macht es nicht als einen Teil der Wirklichkeit erfahrbar, sie läßt es nur in Teilen der es ausschließenden Wirklichkeit ressentimenthaft erinnerbar werden, sie bringt es nicht als Gegebenes freibestimmt zum Ausdruck, sondern nur als Verhindertes notgedrungen zur Geltung – und insofern ist sie in der Tat integrierender Faktor und konstitutives Element des Kontroll- und Manipulationsmechanismus, dem das Geschlechtsleben zum Opfer fällt. Und indem sich nun der praktische Widerstand, den der Mann der Auflösung des Geschlechtslebens ins Familienleben leistet, in die Prostitution wirft, unterwirft er sich zugleich nolens volens den einschränkenden Bedingungen und Kontrollmechanismen, denen diese gesellschaftliche Einrichtung ihr Bestehen verdankt und die sie unverbrüchlich repräsentiert. Sowenig, mit anderen Worten, die Prostitution das im gesellschaftlichen Zusammenhang unterdrückte und aus ihm ausgegrenzte Geschlechtsleben überhaupt zu rehabilitieren dient, sowenig taugt sie nun auch dazu, das durch die Trennung von Familie und Arbeit als reale Substanz und soziales Medium des Geschlechterverhältnisses formell in Aussicht gestellte Geschlechtsleben materiell in die Tat umzusetzen und das Versprechen einer das Geschlechterverhältnis erfüllenden Sexualität einzulösen, das sich mit der vom gesellschaftlichen Arbeits- und Kommunikationszusammenhang abgekoppelten bürgerlichen Familie ebensosehr pro forma der abstrakten Zweisamkeit der Geschlechtspartner gegeben wie pro materia der der Frau nach ihrem Ausschluß aus der Sozialität zugewiesenen quasisozialen Aufgaben als Hausfrau und Mutter wieder zurückgenommen zeigt. Die Prostitution kann gegen diese Zurücknahme des Versprechens höchstens protestieren, nicht sie revidieren; in der Verstohlenheit, der Flüchtigkeit, den aus Aufbegehren und Ausweichen, Einspruch und Verleugnung gemischten Kompromißbildungen, in denen sie dem Geschlechtsleben eine verräterische Treue hält, kann die Prostitution unmöglich dem Mann den topisch verschobenen Entfaltungsraum für jene als alternatives Vergesellschaftungsmodell aufscheinende sexualpartnerschaftliche Ehe bieten, die an ihrem eigentlichen gesellschaftlichen Ort der zur Keimzelle der Gesellschaft verklärten mutterschaftlichen Familie zum Opfer fällt.
 |
 |
 |